Kategorie: Abenteuer
#27 – Yann Martel: „Schiffbruch mit Tiger“
Provenienz: geschenkt bekommen
Ungelesen seit: zweieinhalb Jahren
Etwa vor zwei Jahren saß ich im Kino, und es kam der Trailer zum Film „Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger“, der übrigens heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben läuft. Alles wirkte wie von Disney gemalt, und mein Begleiter schüttelte erbost den Kopf und sagte, dieses Kitschfestival werde dem Roman nun wirklich nicht gerecht.
Ich sagte „Aha“ wie Pu der Bär, wenn er etwas nicht verstanden hat, denn ich kannte das Buch überhaupt nicht. Es hat 2002 den Booker Prize gewonnen, das hatte ich entweder nicht mitbekommen oder den Titel vergessen. Wochen später bemerkte ich, dass es in meinem Bücherregal stand. Und da blieb es auch erst mal stehen.
 Jetzt konnte ich der Empörung meines Begleiters endlich nachspüren. Es war aber eine zähe Angelegenheit: An diesem Buch habe ich fast zwei Monate lang herumgelesen. Erst kam mir eine Reisereportage dazwischen, dann die nächste, dann die Buchmesse. Dass ich trotzdem immer wieder Lust hatte, es in die Hand zu nehmen und neu einzusteigen, spricht für Yann Martel.
Jetzt konnte ich der Empörung meines Begleiters endlich nachspüren. Es war aber eine zähe Angelegenheit: An diesem Buch habe ich fast zwei Monate lang herumgelesen. Erst kam mir eine Reisereportage dazwischen, dann die nächste, dann die Buchmesse. Dass ich trotzdem immer wieder Lust hatte, es in die Hand zu nehmen und neu einzusteigen, spricht für Yann Martel.
Der Roman hat drei Ebenen. Die offensichtlichste erzählt vom jungen Pi aus dem indischen Pondicherry, dessen Vater Zoodirektor ist. Die Familie beschließt, nach Kanada auszuwandern, und nimmt einige der Tiere mit, weil sie in Übersee Käufer gefunden haben. Doch der Frachter geht unter, Pi landet alleine auf einem Rettungsboot. Zumindest denkt er das. Bei genauerer Betrachtung ist bereits eine Tüpfelhyäne an Bord, ein Zebra landet nach einem verzweifelten Sprung von der Reling verletzt im Boot, ein Orang-Utan steigt zu, und einen Tiger rettet Pi aus dem Wasser. Fortan lautet die Frage eigentlich: Wer frisst wen zuerst?
Ich verrate wohl kaum zu viel, wenn ich sage: Pi und der Tiger bleiben übrig. Im Trailer des Films wirkte es, als entwickelte sich so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Pi dressiert den Tiger, was funktioniert, solange der den besten Platz im Boot behalten darf, und der Tiger ist auf ihn angewiesen, weil Pi Fische für ihn fängt. Umgekehrt fühlt sich der Junge für die Raubkatze verantwortlich, was ihn am Leben hält. Es entwickelt sich eine Pattsituation. Das Leben an Bord ist hart, obwohl das Boot mit Notreserven und Gerätschaften zur Trinkwassergewinnung ausgerüstet ist. Hier habe ich allerdings einen einzigen kleinen Kritikpunkt: Es gibt Wasserdosen an Bord, Pi sammelt Regenwasser, und die Geräte produzieren bei Sonnenschein etwa sechs Liter Wasser am Tag. Das sollte für Pi und den Tiger doch einigermaßen reichen. Trotzdem verdurstet er fast.
Der zweiten Ebene widmet sich vor allem der Einstieg. Pi hat ein besonderes Verhältnis zur Religion: Als Hindu wurde er geboren, später lässt er sich zusätzlich taufen und tritt zum Islam über. Aber nicht etwa nacheinander, nein, er praktiziert all diese Religionen parallel mit großer Ernsthaftigkeit und Frömmigkeit. Dieser Aspekt tritt während des Dümpelns im Pazifik etwas in den Hintergrund. Natürlich betet Pi auch dort zu Gott, aber ich möchte den Schiffbrüchigen sehen, der das nicht tut. Später wird seine Religiosität wieder aufgegriffen – mit der dritten Ebene als Vehikel.
Die dritte Ebene tritt ganz zum Schluss aus der Kulisse. Der gerettete Pi erzählt von den Tieren im Boot, aber man glaubt ihm nicht so recht. Denn der Tiger hat sich sofort aus dem Staub gemacht, als das Boot einen Strand erreichte. Da erzählt Pi eine andere Geschichte, und dazu kann ich nun wirklich nichts verraten, außer: Alleine für diese Pointe lohnt sich das ganze Buch. Das ist ganz großartig.
Schließlich wird Pi gefragt, welche Geschichte denn nun wahr sei. Man einigt sich darauf, dass die mit den Tieren besser sei, auch wenn man die Wahrheit nicht kennen könne. Deshalb wolle man lieber diese glauben. Und hier kommen wir zurück zur zweiten Ebene: Denn so, sagt Pi, sei es ja auch mit der Religion.
Wir haben es also mit einem großen Gleichnis zu tun, einer Veranschaulichung der Kraft von Metaphern. Das klingt jetzt viel verkopfter, als es sich liest. Aber wenn ein spannendes Buch schon mal so viel Hintersinn aufweist, darf man ihn nicht unter den Tisch kehren.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Wird sehr liebgehabt und niemals verliehen.
Yann Martel: „Schiffbruch mit Tiger“. Roman. Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2003. 528 Seiten, gebunden, 10 Euro.
#21 – Ernest Hemingway: „Die grünen Hügel Afrikas“
Provenienz: Wenn ich das wüsste, würde ich es zurückgeben.
Ungelesen seit: Die Ausgabe ist von 1962, das beschreibt den gefühlten Zeitraum recht gut.
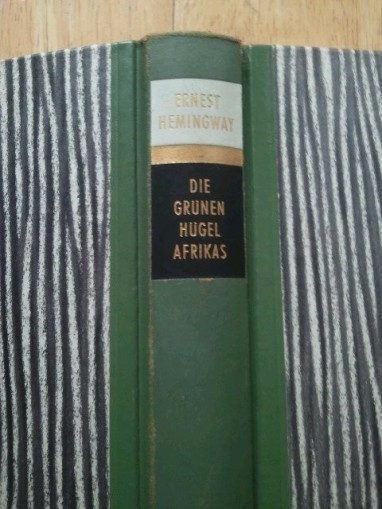 Ich glaubte, Hemingway zu mögen. In „Paris – Ein Fest fürs Leben“ hat mir gefallen, wie er mit seiner ersten Frau in einer Bruchbude haust und sein letztes Geld in die Leihbücherei trägt. Ich wusste, dass er begeistert fischte und jagte, und fand das okay. Was mir nicht klar war: Dieses Jagen schließt Großwildjagd auf Nashörner, Leoparden und Löwen mit ein. Davon handelt „Die grünen Hügel Afrikas“, und es ist explizit als Tatsachenbericht deklariert. In der Vorbemerkung erklärt Hemingway, er habe versucht, „ein wirklich wahres Buch zu schreiben, um festzustellen, ob die Eigenart eines Landes und die Eindrücke eines vierwöchigen Jagdunternehmens bei wahrheitsgetreuer Darstellung neben einem Werk der Phantasie bestehen können“.
Ich glaubte, Hemingway zu mögen. In „Paris – Ein Fest fürs Leben“ hat mir gefallen, wie er mit seiner ersten Frau in einer Bruchbude haust und sein letztes Geld in die Leihbücherei trägt. Ich wusste, dass er begeistert fischte und jagte, und fand das okay. Was mir nicht klar war: Dieses Jagen schließt Großwildjagd auf Nashörner, Leoparden und Löwen mit ein. Davon handelt „Die grünen Hügel Afrikas“, und es ist explizit als Tatsachenbericht deklariert. In der Vorbemerkung erklärt Hemingway, er habe versucht, „ein wirklich wahres Buch zu schreiben, um festzustellen, ob die Eigenart eines Landes und die Eindrücke eines vierwöchigen Jagdunternehmens bei wahrheitsgetreuer Darstellung neben einem Werk der Phantasie bestehen können“.
Das gleich vorab: Können sie nicht. Hemingway ist mit seiner zweiten Ehefrau und einem Freund aus Amerika unterwegs, und im Grunde will er die ganze Zeit unbedingt einen Kudu schießen. Die haben nämlich prächtige Hörner, und nichts ist ihm wichtiger als die Trophäen. Allerdings kommt kein Kudu vor seine Flinte, und er wird immer übellauniger, weil ihm die Zeit bis zur Rückreise ausgeht. Eine Anspannung, die ich beim besten Willen nicht mitgehen konnte: Mir wäre es recht gewesen, hätte er ohne Kudu-Hörner zurückfliegen müssen.
Weil man die Zeit des Wartens ja mit irgendwas füllen muss, schießt Hemingway eben ein Nashorn und ein paar Perlhühner und Krickenten und erzählt nebenbei, wie sie die bereits erlegten Tiere gejagt haben. Die Protzerei über seine großartigen Fähigkeiten als Schütze und Fährtensucher ist so offensichtlich, dass er sich sogar selbst darüber lustig macht. Ach ja, und dann erfreut er sich noch an einer Hyäne, „die, wenn sie beim Laufen zu weit hinten getroffen war, wie verrückt herumkreiselte, nach sich selbst schnappte und an sich zerrte, bis sie sich die eigenen Eingeweide herausriß und dann dastand und sie ruckweise herauszog und sie mit Genuß auffraß“.
Sympathisch, nicht? Aber es wird noch besser. Denn alles, was Hemingway schießt, erwischt sein mitreisender Kumpel in größeren und schöneren Exemplaren, und der Schriftsteller ist dauernd von entsetzlichem Neid und Konkurrenzdenken gepackt. Infolgedessen kann der andere sich nicht freuen, und Hemingway selbst freut sich erst recht nicht mehr über seine nun klein wirkenden Kadaver. Überhaupt schreibt er, nach dem Töten sei er innerlich wie betäubt. Na, so was. Vielleicht wäre es eine Alternative, es dann einfach zu lassen.
Da von der „Eigenart eines Landes“ die Rede war: Es handelt sich um Ostafrika, das jetzige Tansania. Die Menschen dort interessieren Hemingway jedoch nicht. Einen vorbeikommenden Massai behandelt er respektlos, die Träger sind sowieso alle dumm, und als an der Salzlecke, wo die Kudus sein sollten, Spuren eines Menschen sind, schreibt er: „Irgendein Wilder hatte auf unsere Kudus geschossen und sie vom Salz verscheucht, und jetzt wurde die Lecke unbrauchbar.“ Unsere Kudus! Und „irgendein Wilder“, der mit Pfeil und Bogen versucht, seine Familie zu ernähren, während die Touristen mit Großkalibergewehren durch die Gegend ballern und dabei nun wirklich alle Tiere weit und breit verschrecken. Das ist auf so vielen Ebenen unverschämt, dass ich sie gar nicht alle aufzählen mag.
Natürlich ist mir klar, dass Hemingway ein Kind seiner Zeit und seines (reichen, amerikanischen) Milieus war. Aber selbst wenn ich das abziehe, hält sich das kalte Kotzen, das meinen Hals hinaufkriecht.
Was jetzt? Das Buch kommt weg. Es hat keinen Platz bei mir.
Ernest Hemingway: „Die grünen Hügel Afrikas“. Aus dem Amerikanischen von Annemarie Horschitz-Horst. Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1962. 316 Seiten, gebunden, vergriffen.
#3 – Carlos Ruiz Zafón: „Der Schatten des Windes“
Provenienz: Meine Großmutter hat uns zu Weihnachten einen Schwung Bücher gekauft, und jeder sollte sich eines aussuchen. Ich wollte dieses. Bestseller, dachte ich mir, da kannste nicht viel falsch machen.
Ungelesen seit: dreizehn Monaten
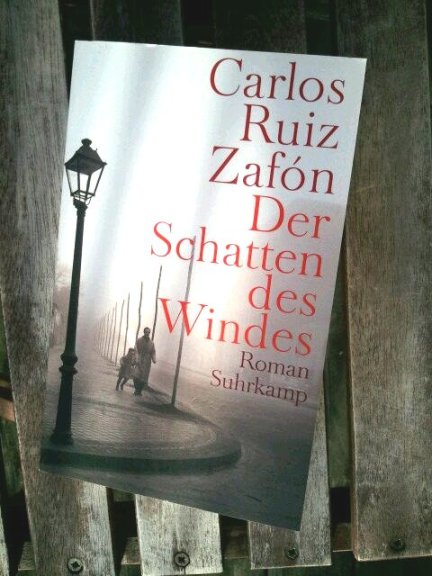 Mit diesem Buch kann man wahrscheinlich Diabetiker töten. Es fängt so dermaßen überkitscht und zuckersüß an, dass ich es kaum ertragen konnte. Der wissbegierige Junge, dessen verwitweter Vater sich so rührend für ihn aufopfert in schwierigen Zeiten. Man meint, in einen Disneyfilm geraten zu sein. Diese Phase muss man erst mal überstehen.
Mit diesem Buch kann man wahrscheinlich Diabetiker töten. Es fängt so dermaßen überkitscht und zuckersüß an, dass ich es kaum ertragen konnte. Der wissbegierige Junge, dessen verwitweter Vater sich so rührend für ihn aufopfert in schwierigen Zeiten. Man meint, in einen Disneyfilm geraten zu sein. Diese Phase muss man erst mal überstehen.
Dann wird es aber schon richtig spannend. Der Junge, Daniel, gerät an ein Buch namens „Der Schatten des Windes“ und ist begeistert davon. Er will alles über den Autor erfahren, aber dessen Geschichte ist geheimnisvoll – und tragisch. Seine weiteren Bücher, die Daniel gerne lesen würde, sind im Laufe der vergangenen Jahre von einem Unbekannten aufgekauft oder gestohlen und verbrannt worden. Nach und nach findet Daniel in Barcelona einige Leute, die ihm etwas über den Autor verraten können. Diese Schnipsel setzt er zusammen und forscht immer weiter.
Eine überaus klassische Erzählweise also, wie in einem Detektivroman. Und glücklicherweise ist die Geschichte spektakulär genug, dass man über die Schweißnähte hinwegsehen kann. Warum nämlich ausgerechnet Daniels große Liebe sich gerne heimlich in ein bestimmtes von all den Häusern in Barcelona zurückzieht, das für seine Recherche wichtig ist – nun ja. Zafón hat diese leichten Konstruktionsschwächen ganz geschickt im Voraus dadurch rechtfertigt, dass zwischen Daniel und dem mysteriösen Autor eine Art magische Verbindung besteht. Das erlaubt ihm das Niederschreiben unglaubwürdigster Zufälle. Cleverer Schachzug.
Die kitschige Grundkonstellation wird übrigens immer mehr abgetragen, je älter Daniel wird und je mehr er von der Welt mitbekommt. In Barcelona kann man nämlich ausgerechnet der Polizei schon seit dem Bürgerkrieg in der 1930er Jahren nicht mehr trauen. Um genau zu sein: Man muss sie fürchten. Was in den Rückblenden vom Bürgerkrieg erzählt wird und was zur Zeitpunkt der Erzählung von dieser Unruhe noch übrig ist, beschreibt Zafón fast nebenbei, aber in drastischen Szenen. Das gibt dem Buch eine politische Tiefe, die es dringend braucht. Sonst könnte es nämlich fast ein ambitionierter Jugendroman sein.
Was jetzt? Ich habe es noch während des Urlaubs, in dem ich es ausgelesen habe, einem Mitreisenden geliehen. Wenn ich ihn richtig einschätze, bekomme ich es zurück. Dann landet es neben Gabriel García Márquez. Ja, ich weiß schon, der ist Kolumbianer. Aber allzu viele Spanier gibt es bisher in meinem Regal nicht.
Carlos Ruiz Zafón: „Der Schatten des Windes“. Aus dem Spanischen von Peter Schwaar. Suhrkamp, Berlin 2012. 562 Seiten, Taschenbuch, 9.99 Euro.