Kategorie: Familie
#44 – Jonathan Franzen: „Unschuld“
Provenienz: Der Mann überreichte es mir, nachdem er mich vorher kaltblütig mit „Freiheit“ angefixt hatte.
Ungelesen seit: Etwa zwanzig Minuten. Ich bin wirklich angefixt.
 Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Der Titel rührt vom Namen der Protagonistin her, Purity, genannt Pip. Eine junge Frau mit widerständigem Geist, haufenweise Studienschulden und einer anstrengenden Mutter. Pip hasst ihren Job, wohnt in einem besetzten Haus und ist unglücklich in einen der Mitbewohner verliebt. In dieser desolaten Situation erhält sie das Angebot, nach Bolivien zu reisen und für eine Organisation zu arbeiten, die entlarvende Regierungsdokumente ebenso online stellt wie Zahnarztskandälchen. Sie fährt hin, sie lernt einen Mann mit zwei Gesichtern kennen, und sie findet im Anschluss heraus, wer ihr stets totgeschwiegener Vater ist. Ich unterschlage jetzt mal sämtliche Details, ihr sollt es schließlich selbst lesen.
Franzen zeichnet seine Figuren sehr plastisch, und er nimmt sich viel Zeit dafür. Über jedermanns Vergangenheit erfahren wir viel, es wird ausgiebig erzählt, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Das ist super, das hätte ich fürs richtige Leben auch gerne. Jemanden, der neben mir hergeht und Dinge sagt wie: „Dein neuer Kollege hat als Kind lange ins Bett gemacht, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hat. Er ist zutiefst unsicher, deshalb wirkt er wie ein arroganter Saftsack.“ Wäre das schön. Und so praktisch! Mein einziger Kritikpunkt an der Geschichte ist, dass mir die Kombination „Alter Mann trifft junge Frau, doch nach ein paar Jahren wird es zäh“ ein bisschen zu oft in leichten Variationen vorkam.
Aber. ABER! Die Übersetzung. Es ist das Grauen. Tut mir leid. Denn eigentlich fallen durchaus wunderschöne Sätze in „Unschuld“. Diese zum Beispiel:
Als arbeitende Journalisten in einer Studentenschaft, die sich nach Studentenmanier vergnügte, erreichten meine Freunde und ich ein Selbstgefälligkeitsniveau, wie es mir erst wieder unterkommen sollte, als ich Mitarbeiter der New York Times kennenlernte. Natürlich hatten wir alle einen Nougatkern der Unschuld, aber jeder prahlte mit seinen sexuellen Großtaten an der Highschool, und dass meine Freunde womöglich logen – ich tat es ja schließlich auch –, dämmerte mir nie.
Nougatkern der Unschuld, hach. Und jetzt kommen wir zu den Negativbeispielen. Es fängt damit an, dass Pip und ihre Mutter besonders geruchsempfindlich sind. „Smell is hell“, sagen sie im amerikanischen Original. Und im Deutschen? „Geruch ist Fluch.“ Waaaahhh! Das reimt sich nicht! Nicht mal im Ansatz! Das macht mich völlig fertig. Was war die Alternative, wenn die Übersetzer das für die beste Lösung hielten? „Riechen ist Siechen“? „Gestank ist Punk“? „Odeur macht’s mir so schwör“? Halten wir fest: Man hätte das einfach gar nicht übersetzen müssen. Schließlich sind auch ganze Sätze auf Spanisch nicht übersetzt. Man versteht das schon, Himmelherrgott.
In Relation dazu ist der Rest Kleinkram, über den man beim Lesen trotzdem stolpert. „Er rümpfte die Brauen“ etwa missfiel mir außerordentlich. Außerdem schreibt der Godfather of Internetenthüllungen in Mails an Pip dauernd LOL. LOL. Wie so ein Teenager anno 2005. „Ihre Mail ist LOL“ – das ist nicht nur miese Grammatik, sondern auch noch peinlich. ROFLCOPTER hätte ich immerhin noch als Ironie durchgehen lassen.
Sehr seltsam mutet auch die Beschreibung an, wie bei der Arbeit am Computer „alle Frauen […] mausten und klickten“. Ich kenne mausen durchaus als Verb, aber in dieser Bedeutung ist es mir noch nie untergekommen. Außerdem kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, die bedeutungsarme Tätigkeit des bloßen Umherschiebens der Maus, bis man wieder eine ihrer Tasten betätigt, habe überhaupt kein eigenes Verb verdient. Diese Stellen haben mich fürchterlich geschmerzt, aber sie können das Buch nicht ruinieren. Ein Glück. Lest es.
Was jetzt? „Die Korrekturen“. Ganz klar.
Jonathan Franzen: „Unschuld“. Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Hamburg 2015. 832 Seiten, gebunden, 26.95 Euro.
#43 – Per Petterson: „Pferde stehlen“
Provenienz: Geschenk zum 30. Geburtstag
Ungelesen seit: Ja, ja. Ich will nicht drüber reden. Pfff.
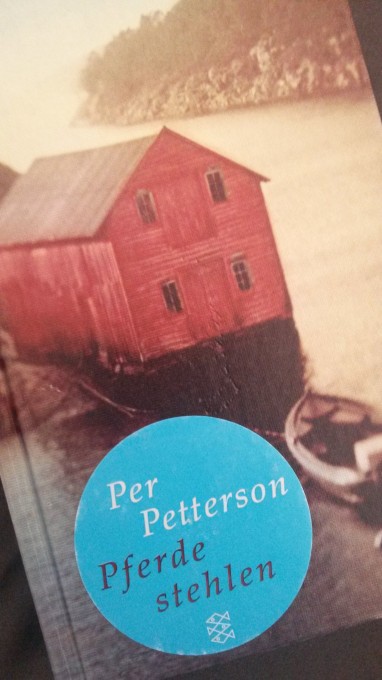 Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Jedenfalls erzählt Per Petterson dann erstmal ausgiebig davon, wie sie früher Baumstämme umgesägt haben. Wie sich das anfühlt in den Muskeln, wie das riecht, wie man schwitzt, wie hungrig man danach ist und wie stolz. SEI-TEN-WEI-SE. Okay, ich lebe in der Großstadt, aber ich kann immerhin Holz hacken und besitze eine Stichsäge – wenn mich das nicht interessiert, also so wirklich null, nada, wen interessiert es dann?
Aber das war ja erst die vergangene Zeitebene. Wir haben ja auch noch eine heutige, in der Trond öde Spaziergänge mit seinem Hund macht, in seinem Nachbarn einen alten Bekannten wiedererkennt und – ihr ahnt es bereits – im Hof eine vom Sturm umgehauene Birke zersägt. Mit Hilfe des Nachbarn, weil Gemeinschaft unter Männern und so, bla bla. Wie toll der Nachbar mit der Kettensäge umgeht, beeindruckend.
Vielleicht könnte man aus diesen Passagen das Editorial des Programms für die nächste Lumberjack-Weltmeisterschaft schnitzen. Aber als Roman, pardon, haben sie mich ins Bodenlose gelangweilt. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht deep genug, den Hintersinn zu erkennen. Wer weiß.
Was jetzt? Will jemand? Ich würde es verschenken. An jemanden mit Lumberjack-Fetisch vielleicht.
Per Petterson: „Pferde stehlen“. Roman. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2009. 335 Seiten, gebunden, 9 Euro.
#42 – Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“
Provenienz: Geschenk zum Dreißigsten (schon wieder! Und immer noch!)
Ungelesen seit: Ja, ja, drei Jahren. Hmpf.
 Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Jetzt aber ist Katarina schwanger von ihrer Sommerliebe Jack, einem Amerikaner, der zu Hause Frau und Kinder hat. Und sie ist auf dem Weg zu ihrer Mutter, um ihr davon zu erzählen: dass sie das Kind will, aber den Mann nicht, obwohl er ihr mehr bedeutet als alle anderen davor. Das Verhältnis zur Mutter ist herzlich, aber nicht unbelastet – als Katarina klein war, wischte sie ihrer Mutter das Blut aus dem Gesicht, wenn der Vater sie wieder krankenhausreif geschlagen hatte. Auch Jack hat eine ähnliche Familiengeschichte. Als Katarina von ihrem Kurzurlaub bei der Mutter zurückkehrt, erwartet er sie – und prügelt auf sie ein, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Gibt es familiäre Muster, aus denen wir nicht ausbrechen können? Zieht Gewalt automatisch Gewalt nach sich? Das sind die großen Fragen, die „Geliebte Tochter“ aufwirft. Katarina wird nach Jacks Schlägen von ihrem Bruder Olof und dessen Frau Erika gesund gepflegt und beginnt, gemeinsam mit ihrer Mutter ihre traumatischen Kindheitserinnerungen aufzuarbeiten. Die Nähe zur Familie tut ihr gut, aber gleichzeitig ist sie eifersüchtig auf die besondere Beziehung ihrer Schwägerin zu ihrer Mutter und empfindet sich als Last, was sie durch finanzielles Engagement auszugleichen sucht.
Marianne Fredriksson widmet sich Katarina, aber sie verliert auch Jack nicht aus den Augen. Er geht zurück nach Amerika, geplagt von Schuldgefühlen, und stürzt dort vollkommen ab, ehe ausgerechnet sein Vater, der früher selbst zugeschlagen hat, ihn auffängt.
Diese ganzen menschlichen Dramen, die sich da aneinander reihen, sind ganz klug und schlicht erzählt. Überhaupt ist der Tonfall sehr geradeheraus, stellenweise in der Übersetzung für meinen Geschmack sogar etwas zu lakonisch geraten. Ein paar inhaltliche Dinge sind ebenfalls irritierend: Olof und Erika haben zwei Jungs aus Vietnam adoptiert, und Jack findet es völlig abgefahren, dass sie „chinesische Kinder“ haben. Der Typ ist New Yorker, sollte ihn ethnische Vielfalt wirklich so aus der Bahn werfen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ach ja, und dann verliebt Katarina sich wieder, diesmal ernsthaft, aber der Mann ist offensichtlich ein Filou. Und was sagt unsere starke, schöne Schwedin da zu ihrer Mutter über ihn? „[Er] ist ein richtiges Hänschen klein, das in die weite Welt hineingeht und sich gern auf sein Mütterlein besinnt.“ Mit dem Mütterlein meint sie sich als seine Lebenspartnerin. Boah. Im Ernst jetzt, Mädels? Ich dachte, wir wären darüber hinweg, Männer als schwachsinnige Kinder darzustellen.
Was jetzt? Das Buch darf bleiben. Wer weiß, vielleicht muss ich mich dem Männerbild ja eines Tages anschließen.
Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“. Roman. Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2010. 368 Seiten, gebunden, 8.90 Euro.
#34 – Gernhardt, Eilert, Knorr: „Erna, der Baum nadelt!“
Provenienz: aus dem tollen Buchpaket zu meinem Dreißigsten
Ungelesen seit: zweieinhalb Jahren
 Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da in die Hand nehme. Robert Gernhardt geht bei mir immer, und die weihnachtliche Anmutung barg eine gewisse Dringlichkeit, das nun nicht bis in den Sommer hinein liegen zu lassen. Es zeigte sich: „Ein botanisches Drama am Heiligen Abend“ ist schnell gelesen. Zumindest beim ersten Mal.
Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da in die Hand nehme. Robert Gernhardt geht bei mir immer, und die weihnachtliche Anmutung barg eine gewisse Dringlichkeit, das nun nicht bis in den Sommer hinein liegen zu lassen. Es zeigte sich: „Ein botanisches Drama am Heiligen Abend“ ist schnell gelesen. Zumindest beim ersten Mal.
Wie der Titel verheißt, geht es um einen plötzlich nadelnden Christbaum. Der steht bei der Familie von Erna und Schorsch Breitlinger, die anfangs entsetzt sind und Nachbarn zu Hilfe rufen. Alle anderen sind auch entsetzt, so dass die Breitlingers schließlich eher stolz sind auf dieses Phänomen und der Presse gern für ein Foto zur Verfügung stehen. Bis das frohe Ereignis nach einer Weile so schnell zu Ende ist, wie es begonnen hat.
Das Ganze ist geschrieben wie ein Theaterstück, und, jetzt kommt’s: in Mundart. Ursprünglich auf Hessisch, was übrigens einer der am leichtesten zu erlernenden Dialekte ist, weil man einfach nur die Zunge loggä lasse muss. Wer sich noch gut an die letzte Betäubung beim Zahnarzt erinnern kann, parliert fließend Hessisch. Aber es gibt da noch ein paar andere hübsche Dialekte. Salzburgerisch etwa, Sächsisch, Schwäbisch – die Übersetzungen in all jene und viele mehr sind dem Hessischen angehängt, und die Riege der Verfasser kommt mit Harry Rowohlt und Otto Waalkes recht illuster daher.
Die ganze Bräsigkeit der Familie Breitlinger und die Bauernschläue, mit der sie schließlich durch den nadelnden Baum berühmt werden möchte, wirken erst im Dialekt richtig authentisch. „Kinner, was e Uffreschung!“ Gleichzeitig hat das Stück in jedem Dialekt eine andere Atmosphäre, weswegen auch nicht langweilig wird, was bei uns an Weihnachten passierte: Nach einer Lesung auf Kölsch folgten die Vorträge auf Bayerisch und Hessisch, und nur die Gans hielt uns davon ab, auch noch den Hamburger Zungenschlag zu würdigen, in der der Baum selbstverständlich nicht nadelt, sondern am Nadeln ist. Dieses enorme Repertoire an Dialekten ist übrigens nur einer von vielen Vorzügen einer umfangreichen Patchworkfamilie.
Solltet ihr also etwas langweilige Feiertage verbracht haben, bei denen euer Vater wieder Geschichten von früher erzählt hat und eure Mutter nur davon redete, dass ihr die Gans diesmal aber wirklich zu trocken geraten sei: Kauft dieses Buch fürs nächste Jahr. Es ist die reinste Stimmungskanone.
Was jetzt? Nächstes Jahr bringe ich das wieder mit. Wir haben ja noch Hamburg vor uns. Und meine Brüder dürfen nur noch Frauen anschleifen, die neue Dialekte mit einbringen.
Robert Gernhardt, Bernd Eilert, Peter Knorr: „Erna, der Baum nadelt!“ Mit Illustrationen von Volker Kriegel. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2010. 103 Seiten, gebunden, 10 Euro.
#23 – Pia Ziefle: „Suna“
Provenienz: Es stand im Regal der Ferienwohnung in Frankreich. Ich stand davor. So fanden wir zusammen.
Ungelesen seit: Nanosekunden
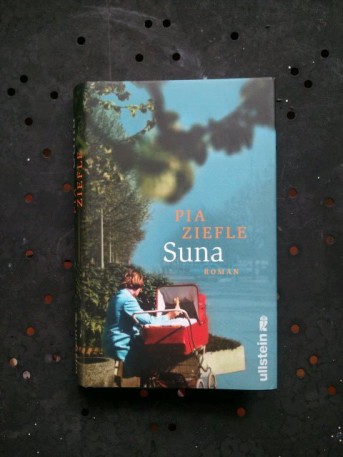 Nein, dieses Buch stand eigentlich nicht auf meiner Leseliste. Ich folge Pia Ziefle auf Twitter, und das schon eine ganze Zeit mit einigem Vergnügen. Dort habe ich von ihrem Buch erfahren, mir aber die Anschaffung verboten, bis ich alle anderen meines Stapels gelesen habe. Tjaha! Und kaum bin ich in Frankreich, sehe ich es im Regal stehen. Es folgte mir willig in die Hängematte, wo ich es innerhalb von zwei Tagen inhalierte. Und das, obwohl wir zu zehnt da waren.
Nein, dieses Buch stand eigentlich nicht auf meiner Leseliste. Ich folge Pia Ziefle auf Twitter, und das schon eine ganze Zeit mit einigem Vergnügen. Dort habe ich von ihrem Buch erfahren, mir aber die Anschaffung verboten, bis ich alle anderen meines Stapels gelesen habe. Tjaha! Und kaum bin ich in Frankreich, sehe ich es im Regal stehen. Es folgte mir willig in die Hängematte, wo ich es innerhalb von zwei Tagen inhalierte. Und das, obwohl wir zu zehnt da waren.
„Suna“ ist stark autobiographisch geprägt. Es handelt von einer jungen Mutter, die ihr selten schlafendes Baby nächtelang durchs Haus trägt und ihm dabei ihre Familiengeschichte erzählt – und damit auch die des Babys. Das füllt einige Nächte, denn die Geschichte ist lang und verworren. Ziefle nimmt die einzelnen Fäden am Anfang auf und lässt sie dann aufeinander zulaufen. So trifft irgendwann eine Serbin im Zug auf zwei Türken, verliebt sich in einen von ihnen, das Drama nimmt seinen Lauf – und zumindest mir war an dem Punkt noch nicht klar, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zu der Erzählerin stehen. Ich konnte nicht so konzentriert lesen wie sonst, daran mag es liegen. Doch die Geschichten sind auch ohne den konkreten Zusammenhang lesenswert.
Das liegt auch daran, dass Pia Ziefle wertfrei schreibt. Die Dinge sind, wie sie sind: die Liebe, die Trennungen, die Kinder, um die sich keiner so richtig kümmern kann. Meist ist daran niemand schuld, im Gegenteil. Keiner kann sich anders verhalten, als er es tut. Diese Erzählweise trägt eine Melancholie in sich, die aufgefangen wird durch den wunderschönen Grundton des Buches. Es ist nämlich so, dass die Erzählerin als Kind von einer deutschen Familie adoptiert wurde und den Kontakt zu ihren internationalen Wurzeln nicht halten konnte. Durch ihr Baby ist ihr allerdings klar geworden, dass sie ihr fehlen. Sie sucht und findet sie, und dann geht sie ihnen auch noch nach: Sie wird in die Türkei reisen und dort ihre ganze große Familie treffen, die wegen eines sprachlichen Missverständnisses dachte, sie sei nicht mehr am Leben.
Das hat mich wirklich berührt. So sehr, dass ich stundenlang knatschig war, weil ich Schwierigkeiten hatte, wieder in der Realität zu landen. So ist das eben manchmal, wenn ein Buch einen packt und mitnimmt.
Was jetzt? Das Buch steht wieder in diesem französischen Bücherregal. Manchmal muss man eine Urlaubsliebe eben zurücklassen.
Pia Ziefle: „Suna“. Roman. Ullstein, Berlin 2012. 304 Seiten, gebunden, 18 Euro.
#22 – Christopher Kloeble: „Meistens alles sehr schnell“
Provenienz: Ich habe seine ersten beiden Bücher in der Abendzeitung gelobt und bekam daraufhin dieses geschickt. Kam aber nie dazu, es zu lesen.
Ungelesen seit: 2012
 Meine Güte, kann der Mann schreiben. Jedenfalls ist es mir wirklich rätselhaft, warum er nicht sehr viel bekannter ist. Er wagt sich an besondere Perspektiven und Themen, sein erstes Buch schrieb er aus der Sicht einer Mutter mittleren Alters – und zwar überzeugend. Das muss man hervorheben in dieser jungen Schriftstellerkohorte, die bevorzugt von ihrem eigenen Bauchnabel berichtet und deren Bücher dann mit „Porträt einer Generation“ beworben werden. Eine Formulierung, die ich noch mehr hasse als Brokkoli.
Meine Güte, kann der Mann schreiben. Jedenfalls ist es mir wirklich rätselhaft, warum er nicht sehr viel bekannter ist. Er wagt sich an besondere Perspektiven und Themen, sein erstes Buch schrieb er aus der Sicht einer Mutter mittleren Alters – und zwar überzeugend. Das muss man hervorheben in dieser jungen Schriftstellerkohorte, die bevorzugt von ihrem eigenen Bauchnabel berichtet und deren Bücher dann mit „Porträt einer Generation“ beworben werden. Eine Formulierung, die ich noch mehr hasse als Brokkoli.
In „Meistens alles sehr schnell“ ist der Ich-Erzähler nicht sonderlich originell, aber dafür seine Umgebung. Albert hat gerade sein Abitur in einem von Nonnen geführten Waisenheim gemacht. Sein Vater Fred ist auf dem geistigen Niveau eines Kindes und kann sich nicht um ihn kümmern, aber sie pflegen trotzdem einen freundschaftlichen Kontakt. Das Verantwortungsgefüge freilich ist nahezu komplett umgedreht im Gegensatz zu üblichen Vater-Sohn-Beziehungen.
Fred ist krank, schwer krank: Er wird bald sterben. Und Albert möchte, vielleicht aus Angst vor Einsamkeit oder im Wissen um eine sich schließende Informationsquelle, nun endlich erfahren, wer seine Mutter ist. Rothaarig muss sie sein, woher sonst sollte Albert seinen knallroten Schopf haben? Allerdings kennt er keine rothaarige Frau im Umfeld seines Vaters. Er verdächtigt die Nachbarin, die bereits ergraut ist, aber das stellt sich als Irrtum heraus. Und aus Fred sind keine konkreten Antworten herauszukriegen.
Nebenbei wird in Rückblenden die spannende Geschichte einer Familie in einem abgeschiedenen bayerischen Ort namens Segendorf erzählt. Inzest ist dort nichts Ungewöhnliches, aber geächtet, und es gibt eine perfide Tradition, die an Janne Tellers berühmtes Jugendbuch „Nichts“ erinnert: Jeder Segendorfer muss einmal im Jahr seinen liebsten Besitz opfern. Alle diese Dinge werden gemeinsam auf einem Haufen verbrannt. Es ist eine düstere Welt, und wie eng sie mit Alberts Geschichte zusammenhängt, erfährt der Leser erst spät.
In Freds Vergangenheit gibt es eine Heldentat, die ebenfalls am Rande zur Auflösung gehört: Er hat ein Baby vor einem herannahenden Bus gerettet, als er wie jeden Tag an der Haltestelle grüne Fahrzeuge zählte. Und dann hat er noch Geheimnisse in der Kanalisation seines Heimatortes. All diese lose wirkenden Stränge und Details webt Kloeble am Ende wieder zusammen.
Warum ich das so gern gelesen habe? Darauf gibt es mehr als eine Antwort. Weil es spannend ist. Weil Kloeble ein Händchen für Figurenzeichnung hat. Weil ich die Auflösung gelegentlich wittern konnte, aber am Ende doch nicht ganz richtig lag. Weil es angenehm schlicht und stilsicher geschrieben ist. Ach, lest es doch einfach selbst!
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Ich freue mich auf sein nächstes Buch.
Christopher Kloeble: „Meistens alles sehr schnell“. Roman. dtv premium, München 2012. 375 Seiten, Softcover, 14.90 Euro.