Kategorie: Personality
#38 – Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder“
Provenienz: Ich wollte ein Buch von Kaléko verschenken. Ganz aus Versehen kaufte ich dann gleich noch ein zweites. Für mich.
Ungelesen seit: etwa einem Jahr
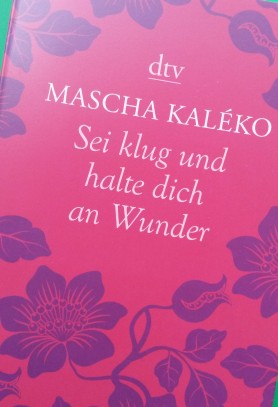 Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
So sehr ich Lyrik liebe, so wenig kann ich meist mit zeitgenössischer Dichtung anfangen. Was ich mag, endet mit wenigen Ausnahmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das war eine goldene Zeit, selbst wenn man nur die populärsten Dichter Kästner, Ringelnatz und Tucholsky berücksichtigt. Mit letzterem übrigens hat Mascha Kaléko die größte Ähnlichkeit. Wie Tucholsky ist sie zugleich lebensklug, gefühlvoll und auf eine lakonische Art sehr, sehr witzig. „Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an!“, schrieb Tucholsky selbst über sie.
Und das war sie, fürwahr. Kommen wir zu den Belegen! In „Ausverkauf in gutem Rat“ etwa schreibt sie:
Denn: So einer in Not ist,
bekommt er immerfort
guten Rat. Seltener, Whisky.
Ganz wunderbar fand ich auch diesen Vierzeiler:
Halte dein Herz an der Leine
Das ist vernünftig, mein Sohn!
(Aber, ganz ehrlich: das meine
Lief mir noch immer davon.)
Wenn endlich mal jemand die Seufzertaste für die Tastatur erfinden würde, könnte ich meine Gefühle in solchen Fällen angemessen zum Ausdruck bringen. So bleibt mir nur, zu schreiben: Lest Mascha Kaléko! Ihr alle! Ihr werdet es nicht bereuen. Ehrlich.
Was jetzt? Regalbrett „Lieblingsdichter“.
Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder. Gedanken über das Leben“. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2013. 170 Seiten, Taschenbuch, 7.90 Euro.
#17 – Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“
Provenienz: Jemand hat mir einen schlauen Satz von Marc Aurel geschickt oder vorgelesen. Daraufhin habe ich dieses Buch gekauft.
Ungelesen seit: Etwa sechs Jahren. Offenbar hatte ich doch nicht so ein großes Bedürfnis nach Schlauheiten, wie ich dachte.
 Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:
Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:
„Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten! Nahezu nichts ist sich fremd. Eines schließt sich ja dem anderen an und schmückt, mit ihm vereinigt, dieselbe Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein, und eine Wahrheit, sofern es auch eine Vollkommenheit für all diese verwandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.“
Wem das jetzt schon irgendwie zu eso ist, der kann getrost woanders weiterlesen – denn Tenor und Wortwahl entsprechen der des ganzen Buches. Man braucht Muße dafür, und man sollte beim Lesen vielleicht auch nicht allzu bequem sitzen, denn sonzzzZZZZt. Wir verstehen uns.
Marc Aurel beschäftigt sich mit der Frage, wie man ein gutes Leben führt. Man soll gemeinnützige Arbeiten verrichten, sich nicht an Klatsch beteiligen, sich weder von Verfehlungen anderer noch vom Lob anderer beeinflussen lassen. Die Vernunft erscheint ihm als höchste Tugend. Angst vor dem Tod hält er für falsch – weil der Tod Teil unseres Daseinszweckes ist. Den schlauen Gedanken, dessentwegen ich das Buch gekauft habe, konnte ich übrigens nicht mehr finden. Oder nicht erkennen – vielleicht finde ich ihn heute banal. Aber es gibt immer wieder Passagen, über die es sich nachzudenken lohnt. Drei habe ich ausgewählt:
„Das Vergehen eines anderen muss man bei ihm lassen.“
„Gewöhne dich bei jeder Handlung eines anderen so viel als möglich daran, bei dir selbst zu untersuchen: ‚Worauf zielt dieser selbst damit ab?‘ Mache aber bei dir selbst den Anfang und forsche dich selbst zuerst aus!“
„Die sich gegenseitig verachten, das sind gerade diejenigen, welche einander zu gefallen streben und die sich untereinander hervortun wollen, sich voreinander bücken.“
Fasziniert hat mich, dass mehrfach die Rede von Atomen ist. Atome, kurz nach Christi Geburt? Ahem. Ich habe also erstmals seit der Oberstufe ein Physik-Thema gegoogelt und erfahren: Die griechischen Philosophen Leukipp (450–370 v. Chr.) und Demokrit (460–371 v. Chr.) stellten sich Materie bereits als Kombination vieler winziger Grundbausteine vor. Die nannten sie „atomos“. Das war allerdings eine durchaus umstrittene These, und zwar jahrtausendelang. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kam man überhaupt in die Nähe einer experimentellen Beweisführung der Existenz von Atomen. Marc Aurel hat also einfach nur frühzeitig mit dem Wimpel des richtigen Teams gewunken und beeindruckt knapp zweitausend Jahre später noch Frauen damit: mich.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Es interessiert mich, ob ich es in zehn oder zwanzig Jahren ganz anders auffasse.
Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“. Marix Verlag, Wiesbaden 2008. 256 Seiten, gebunden, 6 Euro.
#16 – J.R. Moehringer: „Tender Bar“
Provenienz: aus der schönen Sammlung, die mir Kollegen einst schenkten.
Ungelesen seit: ziemlich genau zwei Jahren.
 Es gibt ein paar Bücher, die ich Männern schenke, wenn mir nichts anderes einfällt. „Der König von Mexiko“ von Stefan Wimmer ist so eines. Auch „Man down“ von André Pilz gehört dazu. Jetzt gibt es noch eines: „Tender Bar“ ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, in der sich viele Männer sicher wunderbar wiederfinden. Auch mich hat sie prächtig unterhalten.
Es gibt ein paar Bücher, die ich Männern schenke, wenn mir nichts anderes einfällt. „Der König von Mexiko“ von Stefan Wimmer ist so eines. Auch „Man down“ von André Pilz gehört dazu. Jetzt gibt es noch eines: „Tender Bar“ ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, in der sich viele Männer sicher wunderbar wiederfinden. Auch mich hat sie prächtig unterhalten.
Der Journalist und Schriftsteller J.R. Moehringer beschreibt das Aufwachsen eines jungen Mannes namens J.R. Moehringer, und es spricht nicht für meinen Geisteszustand, dass mir die Namensgleichheit erst nach etwa der Hälfte der Lektüre aufgefallen ist. Aber egal, denn dass das Buch autobiographisch ist, konnte ich dem Klappentext entnehmen (und mir sogar merken, man stelle sich vor). 1964 wird J.R. geboren und wächst mit seiner Mutter und etlichen weiteren Verwandten im chaotischen, düsteren Haushalt seiner Großeltern nahe New Yorks auf. Sein cholerischer Vater ist nur akustisch präsent: Er moderiert eine Radiosendung, und seit die Eltern sich getrennt haben, sitzt J.R. eben vorm Radio und lauscht der Stimme. Die Mutter arbeitet, zieht mit ihrem Sohn aus, scheitert und zieht zurück zu den Großeltern. Das passiert mehrfach, bis sie den Absprung nach Arizona schafft.
Für J.R. ist dieser Umzug keine reine Freude, denn er hat einen Vaterersatz gefunden: Eine Bar namens Dickens, die später in Publicans umbenannt wird und eine Ansammlung der männlichsten Männer zusammenführt, die sich ein Zwölfjähriger vorstellen kann. Sein Onkel Charlie steht hinterm Tresen, und der Moment, da J.R. endlich volljährig ist und selbst einen Drink bestellen darf, ist für ihn wie für alle Anwesenden ein besonders stolzer.
Das Leben in und mit der Bar ist allerdings das Einzige, was bei J.R. reibungsfrei läuft. Er wird wider Erwarten in Yale angenommen, schlägt sich aber dort mehr schlecht als recht durch und kommt nie recht an. Er ist mit der schönsten aller Kommilitoninnen zusammen, aber sie hintergeht ihn. Und er bekommt den Traumjob, ein Volontariat bei der New York Times, aber das erweist sich als Sackgasse: Die Volontäre dürfen dort nur Sandwiches besorgen und Kopien machen, schließlich dann und wann ein Artikelchen schreiben. Sind sie endlich jemandem aufgefallen, arbeiten sie einen Monat zur Probe als richtige Reporter. Als nächstes setzt sich ein geheimer Ausschuss zusammen, der dann ohne Angabe von Gründen den Daumen hebt oder senkt. Wer durchfällt, kann den Rest seines Lebens als Bürobote dort arbeiten – oder eben gehen. Kurz nach dem Beginn von J.R.s Volontariat beschließen die Redakteure inoffiziell, dass keiner der Volontäre mehr übernommen wird, weil sich das finanziell nicht lohne. Ha. Und ich dachte, in den Achtzigern wäre Journalismus noch ein leichterer Job gewesen als heute.
Zwei Schritte vor, einer zurück: So verläuft das Leben von J.R. Moehringer. Selbst die Bar, die ihm Zuhause und Vater war, fällt am Ende auseinander. Ein melancholischer Ton zieht sich durch den Roman, und das ist großartig: die Verbindung von Alkohol und Melancholie. Sozusagen Buch gewordenes Finnland.
Was jetzt? Das Buch bleibt bei mir und wird sehr lieb gehabt.
J.R. Moehringer: „Tender Bar“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit. Fischer Verlag, Frankfurt 2007. 762 Seiten, gebunden, 10 Euro.
#10 – Richard David Precht: „Lenin kam nur bis Lüdenscheid“
Provenienz: Das habe ich mal zu einer WG-Feier mitgebracht bekommen. Ich glaube, es war unsere Ein-Kleidungsstück-Party. (Nein, es hat sich niemand an das Motto gehalten. An die guten Ideen hält sich ja sowieso nie jemand! Siehe auch „Weltfrieden“.)
Ungelesen seit: Wenn ich richtig liege, seit fünf Jahren.
 Auf die Gefahr hin, dass der oder die Schenkende von damals das hier liest: Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet dieses Buch bekommen habe. Richard David Precht beschreibt darin seine Kindheit und Jugend in Solingen als Kind von relativ bürgerlichen Kommunisten: Die Eltern glorifizieren die DDR und Summerhill, aber die Kinder sollen trotzdem bitteschön Abitur machen und abends pünktlich ins Bett. Diese Art Revolution.
Auf die Gefahr hin, dass der oder die Schenkende von damals das hier liest: Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet dieses Buch bekommen habe. Richard David Precht beschreibt darin seine Kindheit und Jugend in Solingen als Kind von relativ bürgerlichen Kommunisten: Die Eltern glorifizieren die DDR und Summerhill, aber die Kinder sollen trotzdem bitteschön Abitur machen und abends pünktlich ins Bett. Diese Art Revolution.
Ich interessiere mich für nichts davon sonderlich. Interessiert sich überhaupt jemand für Solingen? Nein? Na gut. Es hat jedenfalls durchaus seine Gründe, dass ich das Buch fünf Jahre lang nur bei Umzügen angefasst habe. Und für so wenig Interesse meinerseits hat es mich eigentlich ganz gut unterhalten. Schreiben kann er ja, der Precht. Dass ich jetzt das Gefühl habe, den kompletten Inhalt schon im ersten Absatz wiedergegeben zu haben, spricht allerdings Bände.
Also en detail: Die Familie Precht adoptiert neben drei leiblichen Kindern ein Kind aus Vietnam und ein Kind aus Kambodscha. Sie singt Degenhardt-Lieder am Lagerfeuer mit langhaarigen Freunden. Sie wählt die ideologisch richtigen Kinderbücher aus. Als der kleine Richard mal in die DDR kommt, kennen die Kinder dort alle Lassie und Flipper – aber er selbst darf solche bösen, kapitalistischen US-Serien zu Hause in Solingen nicht gucken. Richard wächst übrigens lange kaum, dann plötzlich sehr groß, aber bei den Mädchen hilft ihm beides nicht. Die Kinder der Familie tragen grauenvolle Klamotten aus der Altkleidersammlung, weil es den Eltern egal ist, ob sie gehänselt werden: Schließlich gibt es so viel Wichtigeres auf der Welt.
Eigentlich hätte Precht bei diesen ganz persönlichen Erzählungen bleiben sollen. Leider hielt er es für nötig, an entsprechender Stelle noch mal die Geschichte der RAF zu referieren und nicht einfach die Auswirkungen auf die Überzeugungen der Eltern zu beschreiben. Das macht das Buch zu einer prima Politik-Lehrstunde für Jugendliche, aber Erwachsene können es großzügig überblättern. Dankbar war ich hingegen für die Informationen über den Vietnam-Krieg, denn der spielt im Bewusstsein meiner Generation eine untergeordnete Rolle. Insgesamt bleibt mir nach dem Buch der Eindruck, den ich weniger plastisch schon zuvor hatte: Der Kommunismus stellt ein großes ästhetisches Problem dar, ist aber eine schöne Idee. Und wie das mit guten Ideen so ist, habe ich ja schon eingangs erklärt.
Was jetzt? Mir ist genau eine Fünfzehnjährige bekannt. Bei nächster Gelegenheit bekommt sie dieses Buch in die Hand gedrückt. Bisschen politische Bildung, the easy way.
Richard David Precht: „Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Meine kleine deutsche Revolution“. List Verlag, Berlin 2007. 351 Seiten, Taschenbuch, 8.95 Euro.
#7 – Franz Kafka: „Betrachtungen über Leben, Kunst und Glauben“
Provenienz: Das muss bei mir gelandet sein, als ich mal über irgendeinen Kafka-Jahrestag geschrieben habe. Durchgelesen habe ich es damals aber nicht.
Ungelesen seit: Hm. Das könnten durchaus fünf Jahre sein.
 Dieses Buch beweist absolut überzeugend, warum man ein Blog schreiben sollte: Selbst die Tagebucheinträge und Notizen von Kafka lesen sich oft unausgegoren. Einige sind auch aus dem Zusammenhang gerissen, nun gut, dafür kann er nichts. Aber die Briefe, in denen er gezwungen war, seine Gedanken etwas mehr in eine Richtung zu lenken – die sind oft einfach toll.
Dieses Buch beweist absolut überzeugend, warum man ein Blog schreiben sollte: Selbst die Tagebucheinträge und Notizen von Kafka lesen sich oft unausgegoren. Einige sind auch aus dem Zusammenhang gerissen, nun gut, dafür kann er nichts. Aber die Briefe, in denen er gezwungen war, seine Gedanken etwas mehr in eine Richtung zu lenken – die sind oft einfach toll.
Die Auswahl lässt ein Bild von Kafka entstehen als Haderer, als Zauderer. Einer, der grundsätzlich schon gerne heiraten würde, der aber, sobald er sich zur Heirat entschließt, „nicht mehr schlafen kann, der Kopf glüht bei Tag und Nacht, es ist kein Leben mehr, ich schwanke verzweifelt herum.“ Einer, dem Sex unheimlich ist. Einer, der beim Schreiben mit seinen Metaphern furchtbar unzufrieden ist. Mit seinen Metaphern! Wir erinnern uns: Das ist der Mann mit dem wunderbaren Satz, ein Buch müsse die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Auch diese Bemerkung stammt übrigens aus einem Brief.
Hochinteressant sind seine Überlegungen zur Erziehung und Familie. Dass Eltern im Allgemeinen gerechter seien zu ihren Kindern als umgekehrt, zum Beispiel. Das würde ich sofort unterschreiben, aber als Kind war ich ganz sicher entgegengesetzter Auffassung – wie also herausfinden, was wahr ist? Dann verliert Kafka noch ein paar Worte über Tyrannei und Sklaverei als Erziehungsmittel. Just als ich das las, saß ich in einer U-Bahn, wo eine Mutter sich zum Sklaven ihrer Kinder gemacht hatte. Sie redeten im Befehlston mit ihr, und sie schien ganz verzaubert von ihnen. Ich weiß also nun, was Kafka meinte.
Und weil es so schön ist, habe ich hier noch ein längeres Zitat. Jahreszeitlich nicht perfekt, aber ist nicht immer irgendwie Anfang des Sommers? Dieser dauert eben noch ein bisschen.
„Es ist sehr leicht, am Anfang des Sommers lustig zu sein. Man hat ein lebhaftes Herz, einen leidlichen Gang, und ist dem künftigen Leben ziemlich geneigt. Man erwartet Orientalisch-Merkwürdiges und leugnet es wieder mit komischer Verbeugung und mit baumelnder Rede, welches bewegte Spiel behaglich und zitternd macht. Man sitzt im durcheinandergeworfenen Bettzeug und schaut auf die Uhr. Sie zeigt den späten Vormittag. Wir aber malen den Abend mit gut gedämpften Farben und Fernsichten, die sich ausdehnen. […] Und wenn man uns nach unserm beabsichtigten Leben fragt, so gewöhnen wir uns im Frühjahr eine ausgebreitete Handbewegung als Antwort an, die nach einer Weile sinkend wird, als sei es so lächerlich unnötig, sichere Dinge zu beschwören.“
Was jetzt? Wahrscheinlich wird es sich zwischen den Aphorismen von Oscar Wilde und den Gedanken von Kurt Tucholsky äußerst wohl fühlen.
Franz Kafka: „Betrachtungen über Leben, Kunst und Glauben“. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2007. 94 Seiten, Taschenbuch, 6 Euro.