Kategorie: Philosophie
#39 – Khalil Gibran: „Der Prophet“
Provenienz: Geschenk von Oma
Ungelesen seit: etwa sieben Jahren
 Wo „spirituelles Kultbuch“ draufsteht, ist ja nun wirklich Vorsicht angezeigt. So auch bei diesem: Khalil Gibran war Libanese, emigrierte in die Vereinigten Staaten und bediente dort die Eso-Klientel, die es offenbar schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab. 1931 ist der Gute gestorben, aber, lächelt und seid froh: Er hat uns dieses Buch hinterlassen.
Wo „spirituelles Kultbuch“ draufsteht, ist ja nun wirklich Vorsicht angezeigt. So auch bei diesem: Khalil Gibran war Libanese, emigrierte in die Vereinigten Staaten und bediente dort die Eso-Klientel, die es offenbar schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab. 1931 ist der Gute gestorben, aber, lächelt und seid froh: Er hat uns dieses Buch hinterlassen.
Der rote Faden ist schnell erzählt: Ein Prophet hat zwölf Jahre lang in einer Stadt gelebt, doch nun muss er sie verlassen, weil sein Schiff kommt und ihn zurück in seine Heimat bringen wird. (Das muss ich mir merken für Konferenzen – in Momenten unerträglicher Langeweile sagen: „Oh, mein Schiff kommt!“ Und dann einfach aufstehen und gehen. Pure Grandezza.)
Die Stadtbewohner wollen ihn aber nicht einfach so gehen lassen, sondern noch ein paar Weisheiten abgreifen. Über den Genuss spricht der Prophet auf Nachfrage, über die Arbeit der nächste, über das Geben, über die Liebe. Das ist alles appetitlich in Kapiteln portioniert, die kann man immer mal anlesen und gucken, ob es zur Erleuchtung führt.
Ihr merkt vielleicht schon: Meins ist das nicht. Als Gründe für meine hochgezogene Augenbraue möchte ich exemplarisch die folgenden Sätze ins Feld führen.
Denn in Wahrheit ist es nur das Leben, das dem Leben gibt – während du, der du dich für einen Gebenden hältst, ein bloßer Zeuge bist.
Denn Müßigsein bedeutet, sich den Jahreszeiten zu entfremden und die Prozession des Lebens zu verlassen, das majestätisch und in stolzem Gehorsam auf die Unendlichkeit zuschreitet.
Vieles in euch ist noch menschlich, und vieles ist noch nicht Mensch, sondern ein ungeschlachter Zwerg, der im Schlaf durch den Nebel irrt auf der Suche nach seinem Erwachen.
Wenn ich mich davon angesprochen fühlte, würde ich mich ganz dringend um Psychopharmaka bemühen.
Aber auch in diesem Buch gibt es etwas Tolles: das Kapitel über die Kinder. Das ist womöglich einigermaßen berühmt, jedenfalls haben meine Großeltern das sehr gemocht und in den Flur gehängt. Deshalb ist es mir schon lange ein Begriff. Als Kind bin ich nicht mal über den zweiten Satz hinaus gekommen, der Anfang lautet nämlich: „Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.“
Jetzt habe ich selbst eine Familie und würde das meiste davon unterschreiben. Im Wesentlichen geht es um das, was der Anfang bereits andeutet: Die Kinder gehören euch nicht, vergesst das nie. „Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. […] Ihr dürft danach streben, ihnen ähnlich zu werden, doch versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. [...] Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile abgeschnellt werden.“
Diesen Teil finde ich wirklich berührend und bedenkenswert, während der Rest mich doch recht umfassend langweilte. Abgesehen von einem einzigen weiteren Gedanken; da geht es um das Spannungsverhältnis von Vernunft und Leidenschaft, das mir durchaus bekannt ist. Da werden beiden wirklich gute Rollen zugeordnet: Die Leidenschaft ist das Segel eines Bootes, und die Vernunft ist das Ruder. Nur auf die Vernunft zu hören, heißt: nicht vorwärts kommen. Und nur auf die Leidenschaft - nun, an diesem unwegsamen Ufer sind wir wahrscheinlich alle schon mal gestrandet.
Was jetzt? Das Kapitel über die Kinder hat die Existenz dieses Buches in meinem Haushalt gerettet.
Khalil Gibran: „Der Prophet“. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Mit Kalligraphien von Hassan Massoudy. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2007. 125 Seiten, broschiert, 5 Euro.
#24 – Jean-Paul Sartre: „La nausée“
Provenienz: Ich kehrte von zwei Monaten Frankreich zurück und überlegte, welches Buch ich nun auf Französisch lesen könnte, um mir die Sprache präsent zu halten. Jemand riet mir zu „La nausée“. Ich habe seltsame Freunde.
Ungelesen seit: 2007
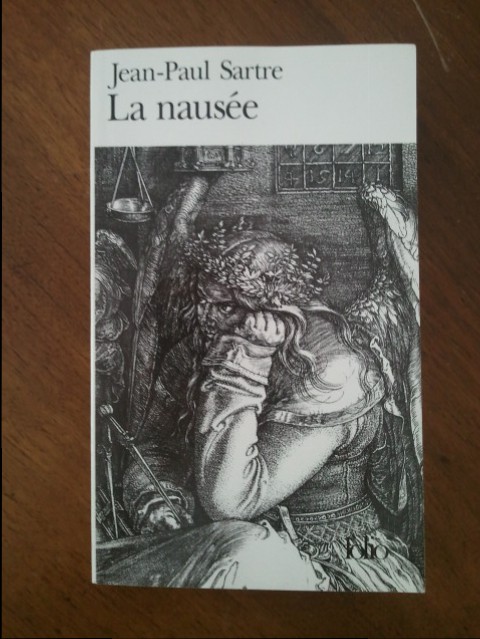 Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Bei „La nausée“ (der deutsche Titel „Der Ekel“ ist irritierend unzutreffend) trat keine dieser beiden Reaktionen ein. Es war viel schlimmer: Ich war von den ersten Seiten an genervt. Der Erzähler ist Historiker, recherchiert in Bibliotheken herum, fühlt sich aber eigentlich der ganzen Sache nicht recht gewachsen. Ihm fehlt die Neigung seiner Berufskollegen, aus einer einzigen Handlung auf die ganze Geschichte zu schließen. Darum fügt sich das Bild über den Diplomaten Rollebon nicht recht zusammen. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem, sondern: Da ist plötzlich dieses merkwürdige Gefühl, das er vielen Dingen und Menschen gegenüber empfindet. „Ça s’est installé sournoisement, peu à peu ; je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné, voilà tout.“ („Es fing unbemerkt an, ganz allmählich; ich fühlte mich etwas seltsam, etwas unbehaglich, das war schon alles.“)
Ab diesem Punkt ergeht der Erzähler sich in Betrachtungen. Und die sind wunderbar geschrieben: Vom Verhalten der Herren, die im Café Karten spielen, über das Aussehen des Wirtes, bis zum Klang der Musik, die er dort hört. Außerdem hat „La nausée“ recht witzige Momente. Als der weitgereiste Erzähler nämlich erklärt, er sei ein hervorragender Erzähler von Anekdoten: „Pour l’anecdote je ne crains personne, sauf les officiers de mer et les professionnels“ – „Bei Anekdoten fürchte ich niemanden, außer Marineoffizieren und Prostituierten“.
Was mich aber unglaublich gestört hat, war die wehleidige Haltung des Erzählers. Ich weiß schon, Hauptwerk des Existenzialismus und alles, aber trotzdem wollte ich ihm dauernd einen Kakao reichen und ihn zum Jammern vor die Tür schicken. Das hat mich selbst überrascht, denn ich mag die etwas wehleidigen Erzähler ja eigentlich, siehe Genazino. Aber mir hat bei Sartre die Selbstironie gefehlt, und ja, es ist durchaus möglich, dass dieses Buch vor Selbstironie strotzt und ich es nicht gerafft habe, weil mein Französisch nicht perfekt ist. Aber ich glaube es eher nicht. Die Ironie, die sich auf die Beobachteten bezieht, habe ich nämlich durchaus mitbekommen. Davon gibt es reichlich, das ist auch durchaus amüsant.
Jedenfalls führt die neue, distanzierte Betrachtungsweise der Welt dazu, dass der Erzähler den Sinn der Existenz anzuzweifeln beginnt. Diese eine Wurzel da im Park, warum genau gibt es die? Könnte es sie nicht auch nicht geben? Warum ist sie diese und nicht eine andere? Ich erinnere mich, mir solche Fragen auch mal gestellt zu haben. Da war ich in der Pubertät und wahrscheinlich selbst ziemlich wehleidig. Also bin ich vielleicht mit der Lektüre einfach nur etwas zu spät dran, in meinem hohen Alter.
Was jetzt? Die Vernunft sagt: Schmeiß weg. Die Eitelkeit sagt: Stell’s ins Regal.
Mal sehen, wer gewinnt.
Jean-Paul Sartre: „La nausée“. Roman. Editions Gallimard, 2007. 250 Seiten, Taschenbuch, 8.80 Euro.
#17 – Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“
Provenienz: Jemand hat mir einen schlauen Satz von Marc Aurel geschickt oder vorgelesen. Daraufhin habe ich dieses Buch gekauft.
Ungelesen seit: Etwa sechs Jahren. Offenbar hatte ich doch nicht so ein großes Bedürfnis nach Schlauheiten, wie ich dachte.
 Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:
Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:
„Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten! Nahezu nichts ist sich fremd. Eines schließt sich ja dem anderen an und schmückt, mit ihm vereinigt, dieselbe Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein, und eine Wahrheit, sofern es auch eine Vollkommenheit für all diese verwandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.“
Wem das jetzt schon irgendwie zu eso ist, der kann getrost woanders weiterlesen – denn Tenor und Wortwahl entsprechen der des ganzen Buches. Man braucht Muße dafür, und man sollte beim Lesen vielleicht auch nicht allzu bequem sitzen, denn sonzzzZZZZt. Wir verstehen uns.
Marc Aurel beschäftigt sich mit der Frage, wie man ein gutes Leben führt. Man soll gemeinnützige Arbeiten verrichten, sich nicht an Klatsch beteiligen, sich weder von Verfehlungen anderer noch vom Lob anderer beeinflussen lassen. Die Vernunft erscheint ihm als höchste Tugend. Angst vor dem Tod hält er für falsch – weil der Tod Teil unseres Daseinszweckes ist. Den schlauen Gedanken, dessentwegen ich das Buch gekauft habe, konnte ich übrigens nicht mehr finden. Oder nicht erkennen – vielleicht finde ich ihn heute banal. Aber es gibt immer wieder Passagen, über die es sich nachzudenken lohnt. Drei habe ich ausgewählt:
„Das Vergehen eines anderen muss man bei ihm lassen.“
„Gewöhne dich bei jeder Handlung eines anderen so viel als möglich daran, bei dir selbst zu untersuchen: ‚Worauf zielt dieser selbst damit ab?‘ Mache aber bei dir selbst den Anfang und forsche dich selbst zuerst aus!“
„Die sich gegenseitig verachten, das sind gerade diejenigen, welche einander zu gefallen streben und die sich untereinander hervortun wollen, sich voreinander bücken.“
Fasziniert hat mich, dass mehrfach die Rede von Atomen ist. Atome, kurz nach Christi Geburt? Ahem. Ich habe also erstmals seit der Oberstufe ein Physik-Thema gegoogelt und erfahren: Die griechischen Philosophen Leukipp (450–370 v. Chr.) und Demokrit (460–371 v. Chr.) stellten sich Materie bereits als Kombination vieler winziger Grundbausteine vor. Die nannten sie „atomos“. Das war allerdings eine durchaus umstrittene These, und zwar jahrtausendelang. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kam man überhaupt in die Nähe einer experimentellen Beweisführung der Existenz von Atomen. Marc Aurel hat also einfach nur frühzeitig mit dem Wimpel des richtigen Teams gewunken und beeindruckt knapp zweitausend Jahre später noch Frauen damit: mich.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Es interessiert mich, ob ich es in zehn oder zwanzig Jahren ganz anders auffasse.
Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“. Marix Verlag, Wiesbaden 2008. 256 Seiten, gebunden, 6 Euro.