Kategorie: Ernstes
#43 – Per Petterson: „Pferde stehlen“
Provenienz: Geschenk zum 30. Geburtstag
Ungelesen seit: Ja, ja. Ich will nicht drüber reden. Pfff.
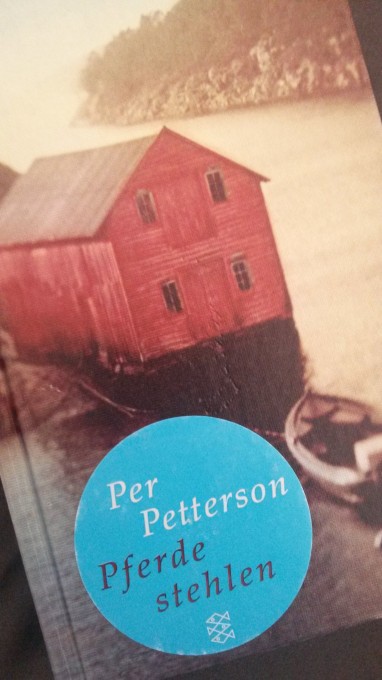 Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Jedenfalls erzählt Per Petterson dann erstmal ausgiebig davon, wie sie früher Baumstämme umgesägt haben. Wie sich das anfühlt in den Muskeln, wie das riecht, wie man schwitzt, wie hungrig man danach ist und wie stolz. SEI-TEN-WEI-SE. Okay, ich lebe in der Großstadt, aber ich kann immerhin Holz hacken und besitze eine Stichsäge – wenn mich das nicht interessiert, also so wirklich null, nada, wen interessiert es dann?
Aber das war ja erst die vergangene Zeitebene. Wir haben ja auch noch eine heutige, in der Trond öde Spaziergänge mit seinem Hund macht, in seinem Nachbarn einen alten Bekannten wiedererkennt und – ihr ahnt es bereits – im Hof eine vom Sturm umgehauene Birke zersägt. Mit Hilfe des Nachbarn, weil Gemeinschaft unter Männern und so, bla bla. Wie toll der Nachbar mit der Kettensäge umgeht, beeindruckend.
Vielleicht könnte man aus diesen Passagen das Editorial des Programms für die nächste Lumberjack-Weltmeisterschaft schnitzen. Aber als Roman, pardon, haben sie mich ins Bodenlose gelangweilt. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht deep genug, den Hintersinn zu erkennen. Wer weiß.
Was jetzt? Will jemand? Ich würde es verschenken. An jemanden mit Lumberjack-Fetisch vielleicht.
Per Petterson: „Pferde stehlen“. Roman. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2009. 335 Seiten, gebunden, 9 Euro.
#31 – Imre Kertész: „Detektivgeschichte“
Provenienz: adoptiert, weil vom Mann aussortiert
Ungelesen seit: etwa einem halben Jahr
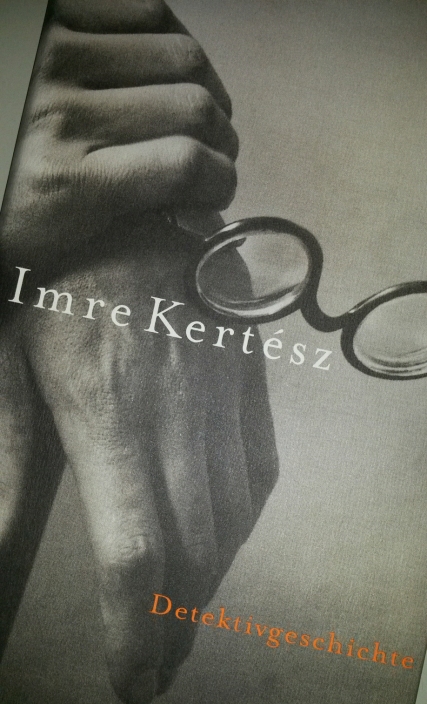 Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
Deshalb konnte ich es nicht mitansehen, wie die „Detektivgeschichte“ aus dem Regal flog. Erneut geht es um das Leben in einer Diktatur, aber diesmal befindet sich der Erzähler auf der Seite der Überwacher und Verfolger. Kertész wollte dieses Thema unbedingt aufgreifen, aber das war in Ungarn 1977 nicht ganz einfach. Es gab nur staatliche Buchverlage, und die Regierung hätte sich durchaus gemeint fühlen können. Deshalb verlegte Kertész die Handlung seines kurzen Romans in ein imaginäres Land in Südafrika. Das reichte offensichtlich aus, um die Zensoren zu befrieden.
Antonio Martens hat beim Geheimdienst angeheuert, weil ihm das von der Kripo aus als Karriereschritt erschien. Jetzt ist er in einem Team mit einem eiskalten Chef und einem bösartigen, sadistischen Kollegen. Bald haben die drei den Sohn eines schwerreichen Kaufhausbesitzers im Visier, der etwas gegen das Regime unternehmen will. Allerdings will keiner aus der Studentenbewegung etwas mit ihm zu tun haben. Sein Vater hingegen gibt sich ihm schließlich als Widerständler zu erkennen und setzt ihn als Kurier ein. Der Geheimdienst kommt dahinter und verhaftet und foltert beide. Soweit die Fakten.
Aber es ist nicht genau so, wie es aussieht. Der Vater hat sein ganz eigenes Ding gedreht, und Unschuldige müssen sterben, um die Behörde nicht in Misskredit zu bringen. Später wird Antonio Martens vor Gericht gestellt und erzählt vom Vorgehen des Geheimdienstes mit zusätzlichen Informationen aus dem Tagebuch des Sohnes, das er sich unter den Nagel gerissen hat. Er wirkt dabei abgestumpft, mit ganz wenigen Ausnahmen. Da ist sie wieder, diese neutrale Erzählweise von Kertész, die einen fertig machen kann. Fertig, wütend, entsetzt – und absolut fasziniert.
Was jetzt? Das behalte ich. Es wird nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein.
Imre Kertész: „Detektivgeschichte“. Roman. Aus dem Ungarischen von Angelika und Peter Máté. Rowohlt Verlag, Hamburg 2004. 138 Seiten, gebunden, 12.90 Euro.
#29 – Tobie Nathan: „Verliebt machen. Warum Liebe kein Zufall ist“
Provenienz: für die Recherche zu einem Artikel bestellt
Ungelesen seit: zwei Tagen
 Wir haben es hier mit einem schönen Beispiel von strikt auf den Markt ausgerichteter Verkaufe zu tun. Zusätzlich zum Titel und Untertitel findet sich daher noch der Blurp aus L’Express auf dem Cover, in dem von Strategien die Rede ist. Man glaubt eine Auflistung von Tricks in der Hand zu halten, mit der man praktisch jedermanns Herz erobern kann. Aber so ist es nun wirklich nicht.
Wir haben es hier mit einem schönen Beispiel von strikt auf den Markt ausgerichteter Verkaufe zu tun. Zusätzlich zum Titel und Untertitel findet sich daher noch der Blurp aus L’Express auf dem Cover, in dem von Strategien die Rede ist. Man glaubt eine Auflistung von Tricks in der Hand zu halten, mit der man praktisch jedermanns Herz erobern kann. Aber so ist es nun wirklich nicht.
Tobie Nathan stammt aus Ägypten, lebt seit Jahrzehnten in Frankreich und ist dort einer der großen Intellektuellen. Psychologe, Ethnologe, und dann schreibt er auch noch Bücher und war als Kulturattaché in Israel und Guinea. Der gibt keine Tipps à la „Tragen Sie doch mal die Haare offen“. Nathan erzählt aus seiner Praxis im psychotherapeutischen Zentrum für Migranten, dessen Mitbegründer er ist. Dort hat er es immer wieder mit Menschen aus Kulturen zu tun, die ganz selbstverständlich daran glauben, dass Liebe erzeugbar ist. In Haiti können das Voodoo-Priester, und in Nordafrika gibt es den Geist Zar, der Menschen überwältigt und in einen Liebeswahn versetzt.
Nathans Patienten kennen einen solchen Liebeswahn. Ein Mann findet in seiner Sockenschublade ein kultisches Objekt, das seine Freundin dort versteckt hat, um Macht über ihn auszuüben. Eine Frau erliegt in Peru einer unvernünftigen Liebe, aus der sie nur ein Zaubertrank rettet. Eine andere schickt dem Mann, der sie verlassen hat, eine seltsame Konstruktion, woraufhin er krank wird. Schön schräg, das alles? Ja.
Nebenbei fächert Nathan bekannte und weniger bekannte Beispiele aus Mythologie und Literatur für den Liebeswahn auf. Wie König David, der sich in Batseba, die Frau seines Soldaten, verliebt. Und Tristan und Isolde, die versehentlich gemeinsam einen Liebestrank schlürfen und nicht mehr voneinander loskommen.
Mein letzter unglücklicher Liebeswahn ist erfreulich lange her, aber ich glaube, dieses Buch wäre damals perfekt für mich gewesen. Sonst fühlt es sich ja immer so an, als renne man gerade alleine in sein Unglück: Nur diese Liebe ist so groß, deshalb muss ich so leiden! Dabei leiden andere auch, und die Liebe stellt sich im Nachhinein manchmal als Strohfeuer heraus. „Wenn es weh tut, ist es keine Liebe“, sagte eine Freundin meiner Mutter oft. Ein Satz zum Merken.
Und die Tricks? Was ist mit den Tricks? Tja, die kommen ganz am Schluss, ein paar zumindest: Tobie Nathan glaubt tatsächlich, dass es hilft, die Geister anzurufen. Am besten dort, wo Menschen Bindungen eingehen: in der Kirche, in der Synagoge, im Standesamt. Außerdem möge man den anderen in suboptimaler Verfassung erwischen. Traurig könne er etwa sein oder sehr müde. Ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesen Empfehlungen halten soll. Sicher ist: Die Traurigen und Müden dieser Welt fand ich noch nie besonders anziehend.
Was jetzt? Ich kenne da jemanden, der ist gerade in genau der richtigen Verfassung für dieses Buch.
Tobie Nathan: „Verliebt machen. Warum Liebe kein Zufall ist“. Aus dem Französischen von Christiane Landgrebe. Berlin Verlag, Berlin 2014. 239 Seiten, gebunden, 19.99 Euro.
#24 – Jean-Paul Sartre: „La nausée“
Provenienz: Ich kehrte von zwei Monaten Frankreich zurück und überlegte, welches Buch ich nun auf Französisch lesen könnte, um mir die Sprache präsent zu halten. Jemand riet mir zu „La nausée“. Ich habe seltsame Freunde.
Ungelesen seit: 2007
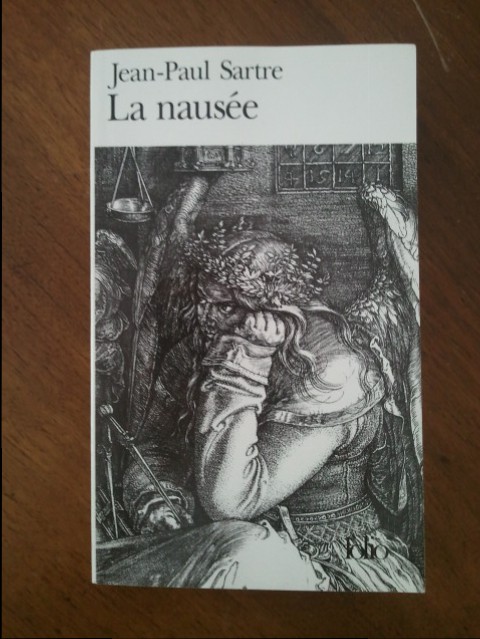 Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Bei „La nausée“ (der deutsche Titel „Der Ekel“ ist irritierend unzutreffend) trat keine dieser beiden Reaktionen ein. Es war viel schlimmer: Ich war von den ersten Seiten an genervt. Der Erzähler ist Historiker, recherchiert in Bibliotheken herum, fühlt sich aber eigentlich der ganzen Sache nicht recht gewachsen. Ihm fehlt die Neigung seiner Berufskollegen, aus einer einzigen Handlung auf die ganze Geschichte zu schließen. Darum fügt sich das Bild über den Diplomaten Rollebon nicht recht zusammen. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem, sondern: Da ist plötzlich dieses merkwürdige Gefühl, das er vielen Dingen und Menschen gegenüber empfindet. „Ça s’est installé sournoisement, peu à peu ; je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné, voilà tout.“ („Es fing unbemerkt an, ganz allmählich; ich fühlte mich etwas seltsam, etwas unbehaglich, das war schon alles.“)
Ab diesem Punkt ergeht der Erzähler sich in Betrachtungen. Und die sind wunderbar geschrieben: Vom Verhalten der Herren, die im Café Karten spielen, über das Aussehen des Wirtes, bis zum Klang der Musik, die er dort hört. Außerdem hat „La nausée“ recht witzige Momente. Als der weitgereiste Erzähler nämlich erklärt, er sei ein hervorragender Erzähler von Anekdoten: „Pour l’anecdote je ne crains personne, sauf les officiers de mer et les professionnels“ – „Bei Anekdoten fürchte ich niemanden, außer Marineoffizieren und Prostituierten“.
Was mich aber unglaublich gestört hat, war die wehleidige Haltung des Erzählers. Ich weiß schon, Hauptwerk des Existenzialismus und alles, aber trotzdem wollte ich ihm dauernd einen Kakao reichen und ihn zum Jammern vor die Tür schicken. Das hat mich selbst überrascht, denn ich mag die etwas wehleidigen Erzähler ja eigentlich, siehe Genazino. Aber mir hat bei Sartre die Selbstironie gefehlt, und ja, es ist durchaus möglich, dass dieses Buch vor Selbstironie strotzt und ich es nicht gerafft habe, weil mein Französisch nicht perfekt ist. Aber ich glaube es eher nicht. Die Ironie, die sich auf die Beobachteten bezieht, habe ich nämlich durchaus mitbekommen. Davon gibt es reichlich, das ist auch durchaus amüsant.
Jedenfalls führt die neue, distanzierte Betrachtungsweise der Welt dazu, dass der Erzähler den Sinn der Existenz anzuzweifeln beginnt. Diese eine Wurzel da im Park, warum genau gibt es die? Könnte es sie nicht auch nicht geben? Warum ist sie diese und nicht eine andere? Ich erinnere mich, mir solche Fragen auch mal gestellt zu haben. Da war ich in der Pubertät und wahrscheinlich selbst ziemlich wehleidig. Also bin ich vielleicht mit der Lektüre einfach nur etwas zu spät dran, in meinem hohen Alter.
Was jetzt? Die Vernunft sagt: Schmeiß weg. Die Eitelkeit sagt: Stell’s ins Regal.
Mal sehen, wer gewinnt.
Jean-Paul Sartre: „La nausée“. Roman. Editions Gallimard, 2007. 250 Seiten, Taschenbuch, 8.80 Euro.
#23 – Pia Ziefle: „Suna“
Provenienz: Es stand im Regal der Ferienwohnung in Frankreich. Ich stand davor. So fanden wir zusammen.
Ungelesen seit: Nanosekunden
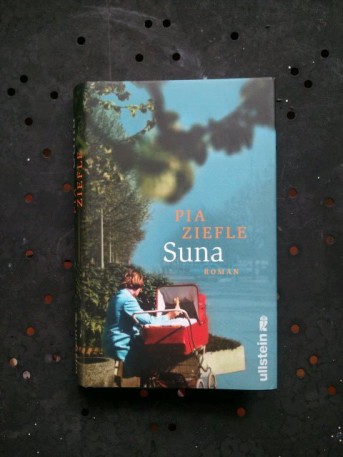 Nein, dieses Buch stand eigentlich nicht auf meiner Leseliste. Ich folge Pia Ziefle auf Twitter, und das schon eine ganze Zeit mit einigem Vergnügen. Dort habe ich von ihrem Buch erfahren, mir aber die Anschaffung verboten, bis ich alle anderen meines Stapels gelesen habe. Tjaha! Und kaum bin ich in Frankreich, sehe ich es im Regal stehen. Es folgte mir willig in die Hängematte, wo ich es innerhalb von zwei Tagen inhalierte. Und das, obwohl wir zu zehnt da waren.
Nein, dieses Buch stand eigentlich nicht auf meiner Leseliste. Ich folge Pia Ziefle auf Twitter, und das schon eine ganze Zeit mit einigem Vergnügen. Dort habe ich von ihrem Buch erfahren, mir aber die Anschaffung verboten, bis ich alle anderen meines Stapels gelesen habe. Tjaha! Und kaum bin ich in Frankreich, sehe ich es im Regal stehen. Es folgte mir willig in die Hängematte, wo ich es innerhalb von zwei Tagen inhalierte. Und das, obwohl wir zu zehnt da waren.
„Suna“ ist stark autobiographisch geprägt. Es handelt von einer jungen Mutter, die ihr selten schlafendes Baby nächtelang durchs Haus trägt und ihm dabei ihre Familiengeschichte erzählt – und damit auch die des Babys. Das füllt einige Nächte, denn die Geschichte ist lang und verworren. Ziefle nimmt die einzelnen Fäden am Anfang auf und lässt sie dann aufeinander zulaufen. So trifft irgendwann eine Serbin im Zug auf zwei Türken, verliebt sich in einen von ihnen, das Drama nimmt seinen Lauf – und zumindest mir war an dem Punkt noch nicht klar, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zu der Erzählerin stehen. Ich konnte nicht so konzentriert lesen wie sonst, daran mag es liegen. Doch die Geschichten sind auch ohne den konkreten Zusammenhang lesenswert.
Das liegt auch daran, dass Pia Ziefle wertfrei schreibt. Die Dinge sind, wie sie sind: die Liebe, die Trennungen, die Kinder, um die sich keiner so richtig kümmern kann. Meist ist daran niemand schuld, im Gegenteil. Keiner kann sich anders verhalten, als er es tut. Diese Erzählweise trägt eine Melancholie in sich, die aufgefangen wird durch den wunderschönen Grundton des Buches. Es ist nämlich so, dass die Erzählerin als Kind von einer deutschen Familie adoptiert wurde und den Kontakt zu ihren internationalen Wurzeln nicht halten konnte. Durch ihr Baby ist ihr allerdings klar geworden, dass sie ihr fehlen. Sie sucht und findet sie, und dann geht sie ihnen auch noch nach: Sie wird in die Türkei reisen und dort ihre ganze große Familie treffen, die wegen eines sprachlichen Missverständnisses dachte, sie sei nicht mehr am Leben.
Das hat mich wirklich berührt. So sehr, dass ich stundenlang knatschig war, weil ich Schwierigkeiten hatte, wieder in der Realität zu landen. So ist das eben manchmal, wenn ein Buch einen packt und mitnimmt.
Was jetzt? Das Buch steht wieder in diesem französischen Bücherregal. Manchmal muss man eine Urlaubsliebe eben zurücklassen.
Pia Ziefle: „Suna“. Roman. Ullstein, Berlin 2012. 304 Seiten, gebunden, 18 Euro.
#22 – Christopher Kloeble: „Meistens alles sehr schnell“
Provenienz: Ich habe seine ersten beiden Bücher in der Abendzeitung gelobt und bekam daraufhin dieses geschickt. Kam aber nie dazu, es zu lesen.
Ungelesen seit: 2012
 Meine Güte, kann der Mann schreiben. Jedenfalls ist es mir wirklich rätselhaft, warum er nicht sehr viel bekannter ist. Er wagt sich an besondere Perspektiven und Themen, sein erstes Buch schrieb er aus der Sicht einer Mutter mittleren Alters – und zwar überzeugend. Das muss man hervorheben in dieser jungen Schriftstellerkohorte, die bevorzugt von ihrem eigenen Bauchnabel berichtet und deren Bücher dann mit „Porträt einer Generation“ beworben werden. Eine Formulierung, die ich noch mehr hasse als Brokkoli.
Meine Güte, kann der Mann schreiben. Jedenfalls ist es mir wirklich rätselhaft, warum er nicht sehr viel bekannter ist. Er wagt sich an besondere Perspektiven und Themen, sein erstes Buch schrieb er aus der Sicht einer Mutter mittleren Alters – und zwar überzeugend. Das muss man hervorheben in dieser jungen Schriftstellerkohorte, die bevorzugt von ihrem eigenen Bauchnabel berichtet und deren Bücher dann mit „Porträt einer Generation“ beworben werden. Eine Formulierung, die ich noch mehr hasse als Brokkoli.
In „Meistens alles sehr schnell“ ist der Ich-Erzähler nicht sonderlich originell, aber dafür seine Umgebung. Albert hat gerade sein Abitur in einem von Nonnen geführten Waisenheim gemacht. Sein Vater Fred ist auf dem geistigen Niveau eines Kindes und kann sich nicht um ihn kümmern, aber sie pflegen trotzdem einen freundschaftlichen Kontakt. Das Verantwortungsgefüge freilich ist nahezu komplett umgedreht im Gegensatz zu üblichen Vater-Sohn-Beziehungen.
Fred ist krank, schwer krank: Er wird bald sterben. Und Albert möchte, vielleicht aus Angst vor Einsamkeit oder im Wissen um eine sich schließende Informationsquelle, nun endlich erfahren, wer seine Mutter ist. Rothaarig muss sie sein, woher sonst sollte Albert seinen knallroten Schopf haben? Allerdings kennt er keine rothaarige Frau im Umfeld seines Vaters. Er verdächtigt die Nachbarin, die bereits ergraut ist, aber das stellt sich als Irrtum heraus. Und aus Fred sind keine konkreten Antworten herauszukriegen.
Nebenbei wird in Rückblenden die spannende Geschichte einer Familie in einem abgeschiedenen bayerischen Ort namens Segendorf erzählt. Inzest ist dort nichts Ungewöhnliches, aber geächtet, und es gibt eine perfide Tradition, die an Janne Tellers berühmtes Jugendbuch „Nichts“ erinnert: Jeder Segendorfer muss einmal im Jahr seinen liebsten Besitz opfern. Alle diese Dinge werden gemeinsam auf einem Haufen verbrannt. Es ist eine düstere Welt, und wie eng sie mit Alberts Geschichte zusammenhängt, erfährt der Leser erst spät.
In Freds Vergangenheit gibt es eine Heldentat, die ebenfalls am Rande zur Auflösung gehört: Er hat ein Baby vor einem herannahenden Bus gerettet, als er wie jeden Tag an der Haltestelle grüne Fahrzeuge zählte. Und dann hat er noch Geheimnisse in der Kanalisation seines Heimatortes. All diese lose wirkenden Stränge und Details webt Kloeble am Ende wieder zusammen.
Warum ich das so gern gelesen habe? Darauf gibt es mehr als eine Antwort. Weil es spannend ist. Weil Kloeble ein Händchen für Figurenzeichnung hat. Weil ich die Auflösung gelegentlich wittern konnte, aber am Ende doch nicht ganz richtig lag. Weil es angenehm schlicht und stilsicher geschrieben ist. Ach, lest es doch einfach selbst!
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Ich freue mich auf sein nächstes Buch.
Christopher Kloeble: „Meistens alles sehr schnell“. Roman. dtv premium, München 2012. 375 Seiten, Softcover, 14.90 Euro.
#19 – Stephen Grosz: „Die Frau, die nicht lieben wollte – und andere wahre Geschichten über das Unbewusste“
Provenienz: beim Mann aus dem Bücherregal geflogen, bei mir rein.
Ungelesen seit: vier Monaten
 Irgendwo hab ich mal gelesen, dass „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ eigentlich ganz anders heißen sollte. Der Verlag bestand aber auf der Liebe im Titel, aus Marketinggründen. (Und er tat gut daran, hey, eine größere und romantische literarische Liebesgeschichte gibt es ja wohl kaum.) Jedenfalls fiel mir das wieder ein, weil „Die Frau, die nicht lieben wollte“ eigentlich die lahmste Geschichte im gleichnamigen Buch darstellt. Stephen Grosz ist Psychoanalytiker in London und hat aus seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung einiges zusammengetragen, das zu lesen sich lohnt.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ eigentlich ganz anders heißen sollte. Der Verlag bestand aber auf der Liebe im Titel, aus Marketinggründen. (Und er tat gut daran, hey, eine größere und romantische literarische Liebesgeschichte gibt es ja wohl kaum.) Jedenfalls fiel mir das wieder ein, weil „Die Frau, die nicht lieben wollte“ eigentlich die lahmste Geschichte im gleichnamigen Buch darstellt. Stephen Grosz ist Psychoanalytiker in London und hat aus seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung einiges zusammengetragen, das zu lesen sich lohnt.
Die Geschichten sind wahr, aber die Details so verfremdet, dass die Patienten nicht mehr erkennbar sind. Wie zum Beispiel Peter, der einen Suizidversuch unternommen hat, bei dem er sich selbst mit einem Messer stach. Er hat die Angewohnheit, Freundschaften anzufangen und dann wieder hinzuschmeißen. Schließlich erfährt Grosz durch die Verlobte des Patienten, dieser habe sich nun das Leben genommen. Zwei Jahre später kommt er allerdings wieder zur Therapie. Er hat seinen Tod vorgetäuscht. Warum? Wie die Gespräche zeigen, aus Angst vor Abhängigkeit, weil er als Kind massiv vernachlässigt wurde.
Grosz führt seine Patienten erfreulicherweise nicht als Ansammlung skurriler Psycho-Probleme vor. Er erzählt vielmehr von seiner Herangehensweise und den Schwierigkeiten, die sich für ihn ergeben. Ein Patient schläft immer wieder ein. Eine Patientin wirkt fröhlich und sagt, es gehe ihr blendend, verletzt sich aber selbst. Eine berichtet nur von Panikattacken, ist aber in das Kindermädchen verliebt und versucht heimlich, wieder von ihrem Mann schwanger zu werden, damit die Geliebte den Haushalt nicht verlässt. Mit diesen Situationen zu Rande zu kommen, ist auch für den Therapeuten nicht leicht.
Besonders beeindruckend fand ich die Geschichte von einem verhaltensauffälligen Jungen namens Thomas. Er ist hochaggressiv, die bisherigen Diagnosen sprechen von Autismus, psychotischen und manischen Charakteristika. In den Gesprächen mit Grosz versucht Thomas, ihn auf jede nur erdenkliche Art zu beleidigen, zu provozieren und zu verärgern. Schließlich beginnt er, dem Therapeuten ins Gesicht zu spucken. Jedes Mal. Grosz spürt, dass das das einzige ist, was ihn wirklich wütend auf Thomas macht, und hinterfragt diesen Zusammenhang.
Schließlich stellt er fest, dass Thomas diese Wut unbedingt will – weil die Wut auf ihn zeigt, dass er auch anders sein könnte. Wer sich nicht ärgert, akzeptiert. Thomas will aber nicht akzeptiert werden, wie er ist, denn er ist selbst unglücklich damit. Als Grosz ihn darauf anspricht, sagt der Junge: „Mein Hirn ist kaputt, Blödmann. […] Habe ich Ihnen erzählt, dass meine Schwestern sich gegenseitig das Einmaleins abfragen? Sie sind jünger als ich und können schon so vieles, was ich nicht kann, weil ihr Hirne funktionieren. Meins ist Schrott. […] Das ist doch echt traurig, nicht?“
„Erst im Rückblick ist klar“, schreibt Grosz, „dass Thomas und ich in einer Sackgasse steckten, weil wir beide den Gedanken unerträglich fanden, dass er irreparabel gestört war.“ Erst die beiderseitige Akzeptanz dieses Umstandes führt zur Besserung. Das Kapitel heißt „Wie uns Wut vor Trauer schützt“, und dieses induktive Konzept, die Extremfälle aus der Praxis auf Menschen ohne pathologische psychische Probleme zu beziehen, hat mir sehr gefallen. In dem Zusammenhang sei noch der alte Mann erwähnt, der seine Kinder gerne öfter sähe, aber immer so an ihnen herummeckert, dass sie sich ewig nicht mehr blicken lassen. Dieses Muster kommt wahrscheinlich vielen bekannt vor. Die Erklärung des Psychoanalytikers lautet: Neid. Darauf kann man getrost ein paar Wochen lang herumdenken.
Was jetzt? Das bleibt. Es würde sich gut zwischen Ferdinand von Schirach und Oliver Sacks machen. Wenn ich nur wüsste, wo die sind.
Stephen Grosz: „Die Frau, die nicht lieben wollte – und andere wahre Geschichten über das Unbewusste“. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013. 235 Seiten, gebunden, 19.99 Euro.
#12 – Zeina Abirached: „Das Spiel der Schwalben“
Provenienz: Der beste Bruder von allen hat es mir zu Weihnachten geschenkt.
Ungelesen seit: zweieinhalb Monaten
 Meine Erfahrungen mit graphic novels kann ich ohne großes Kokettieren als verschwindend gering bezeichnen. Ich habe „Persepolis“ von Marjane Satrapi gelesen, aber das war es auch schon. Ist ja auch mal schön, vollkommen
Meine Erfahrungen mit graphic novels kann ich ohne großes Kokettieren als verschwindend gering bezeichnen. Ich habe „Persepolis“ von Marjane Satrapi gelesen, aber das war es auch schon. Ist ja auch mal schön, vollkommen uninformiert unvoreingenommen an die Sache heran zu gehen. Und gleich zu bemerken: Um die Bilder richtig zu verstehen, braucht man eine Weile.
Das liegt am Stil von Zeina Abirached, die Bilder wie Holzschnitte macht. Oft ist dadurch das Wesentliche weiß, und ich musste meine Sehgewohnheiten erst mal umstellen. Abirached erzählt von einer Nacht im Jahre 1984 in Ost-Beirut, mitten im libanesischen Bürgerkrieg. Sie selbst ist noch ein kleines Mädchen und wartet mit ihrem Bruder auf die Rückkehr der Eltern. In dieser Nacht ist es mit den Heckenschützen und Granaten draußen besonders schlimm, deshalb wagen die Eltern es nach einem Besuch bei der Großmutter nicht, den kurzen Weg über die gefährlichen Straßen nach Hause anzutreten.
Die Kinder haben sich in die Diele zurückgezogen, wo die Familie inzwischen fast ausschließlich lebt. Das ist der sicherste Raum der Wohnung, des Hauses sogar, weil er im ersten Stock liegt. Deshalb kommen jeden Abend die Nachbarn vorbei. An diesem Abend bringen sie Salat mit, es wird ein Kuchen gebacken, Whisky getrunken und aus „Cyrano de Bergerac“ zitiert. Alle sorgen sich um die Eltern der Kinder, aber Zeina Abirached lässt auch eine große Geborgenheit in den Bildern um ihre Figuren entstehen. Gelegentlich sind sie sogar verblüffend witzig. Die Autorin nimmt sich die Zeit, die Geschichten der Nachbarn zu erzählen, und verrät en passant viel darüber, wie liberal der Libanon in den Siebzigern schon war. Trotzdem wartet der Horror die ganze Zeit vor der Haustür.
Ich bin fast derselbe Jahrgang wie die Autorin. Es berührt mich deshalb besonders, was sie als Kind erleben musste, während ich Plastikponys gekämmt habe. Meine erste weltpolitische Erinnerung ist die an Tschernobyl, und man kann nicht behaupten, dass ich damals die Tragweite auch nur ansatzweise erfasst hätte: Ich fragte, ob der Spinat nun auch vergiftet sei, und freute mich sehr, als meine Mutter dies bejahte. Es war die Insel der Seligen, und andere Kinder lebten im Krieg. Sich das immer mal wieder bewusst zu machen, kann wirklich nicht schaden.
Was jetzt? Das Buch bleibt bei mir. Es wird sich eine gute Gesellschaft dafür finden.
Zeina Abirached: „Das Spiel der Schwalben“. Graphic Novel. Avant-Verlag, Berlin 2013. 182 Seiten, broschiert, 19.95 Euro.
#11 – Sibylle Lewitscharoff: „Blumenberg“
Provenienz: Ich wollte dieses Buch schon lange lesen und habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Jetzt ärgere ich mich darüber.
Ungelesen seit: zweieinhalb Monaten
Auf Seite 80 war ich angelangt, als ich abends über diesen Offenen Brief stolperte. Lewitscharoff hatte im Dresdner Schauspielhaus eine Rede gehalten, die man als menschenverachtend bezeichnen muss. Hier gibt es sie in voller Länge zum Nachlesen.
Mein erster Impuls war: Ich lese das Buch nicht zu Ende. Ich weigere mich, ein Buch von einer Frau zu lesen, die andere aufgrund ihres Kinderwunsches oder der Art ihrer Zeugung so pauschal und kaltherzig verurteilt.
Aber dann fiel mir die Position ein, die ich zur Trennung von Autor und Werk immer vertreten habe. Bestimmt sind unter meinen Lieblingsbüchern auch welche von Schriftstellern mit ekelhaften Überzeugungen. Die waren zwar immerhin so freundlich, sie nicht voll umfänglich in die Welt hinaus zu blasen, aber wer weiß. Ich habe es also zu Ende gelesen. Ein Buch von Lewitscharoff zu kaufen, würde ich in Zukunft aber auch unterlassen, wenn mir „Blumenberg“ gefallen hätte. Eine Wirtschaftseinheit sind Autor und Werk nämlich durchaus, und ich kaufe schließlich auch nichts von Müller-Milch, seit Herr Müller mehrere Journalisten tätlich angegriffen hat.
Gleichzeitig ist es mir heute unmöglich, nicht zu ihrer Rede Stellung zu beziehen, wenn ich über Lewitscharoff schreibe. Gerade ärgert mich vor allem ihre Slalom-Taktik. „Gemeinhin bin ich bestrebt, meinen Vorträgen durch Scherze und ein kleines Fluten der Ironie eine gewisse Leichtigkeit zu verschaffen, damit der Ernst, der sich darin auch zu Wort meldet, besser verdaut werden kann. Bei dem heute gewählten Thema fällt mir das schwer“, sagte sie einleitend. Dann bezeichnete sie ein Verbot der Onanie als „weise“ und sagte über die Kinder künstlicher Befruchtung, „dass ich sogar geneigt bin, Kinder, die auf solch abartigen Wegen entstanden sind, als Halbwesen anzusehen. Nicht ganz echt sind sie in meinen Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weißnichtwas.“
Im Interview mit der F.A.Z. verkaufte sie die Onanie-Bemerkung dann als Polemik und Ironie – in einer Rede, die sie vorher eigens als ernst angekündigt hatte. Sie habe dazu gedient, die Zuhörer aufzuwecken. Wer Zuhörer nicht ohne solchen Unsinn aufwecken kann, sollte vielleicht einfach keine Reden vor bequemen Polsterstühlen halten. Die Bezeichnung „Halbwesen“ weigerte sie sich jedoch zurückzunehmen. Nur um sich später im „Morgenmagazin“ auch dafür zu entschuldigen, nachdem selbst der Suhrkamp-Verlag sich bereits von seiner Autorin distanziert hatte. Manchem klang bereits die Rede nach Kalkül zum Marketing ihres neuen Buches. Ich habe den Eindruck, sie denkt erst seit dem öffentlichen Aufschrei an ihre Verkaufszahlen.
Ich habe Freunde, die zu den Menschen gehören, die Lewitscharoff so rüde aburteilt. Menschen mit großem Kinderwunsch, die fantastische Eltern sein werden, wenn es denn endlich mit ein bisschen Hilfe geklappt hat. Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, wie man so verbohrt sein kann, ihnen die Chance auf eine Familie abzusprechen. Und ich staune, wie jemand, der sich immer wieder auf die Bibel beruft, so wenig Nächstenliebe in sich tragen kann.
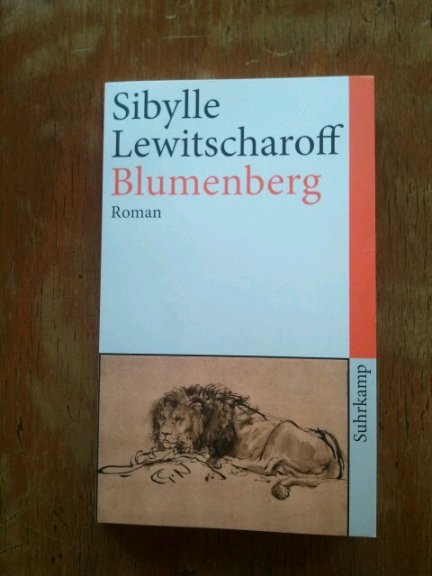 Kommen wir zum Buch. Ich kann nicht ausschließen, dass mein Ärger mich da beeinflusst hat, aber ich war schon vor dem Vorfall nicht begeistert. Lewitscharoff hat eine Hommage an den Philosophen Blumenberg verfasst, und ich konnte nicht fassen, dass der Klappentext ihn als „hochsympathisch“ bezeichnet. Ich fand die Figur lächerlich und musste erst mal googeln, ob das Buch nicht doch als Satire gemeint ist. Ist es nicht.
Kommen wir zum Buch. Ich kann nicht ausschließen, dass mein Ärger mich da beeinflusst hat, aber ich war schon vor dem Vorfall nicht begeistert. Lewitscharoff hat eine Hommage an den Philosophen Blumenberg verfasst, und ich konnte nicht fassen, dass der Klappentext ihn als „hochsympathisch“ bezeichnet. Ich fand die Figur lächerlich und musste erst mal googeln, ob das Buch nicht doch als Satire gemeint ist. Ist es nicht.
Blumenberg sieht eines Tages einen Löwen in seinem Arbeitszimmer, der ihn fortan begleitet. Er macht sich allerlei hochtrabende Gedanken darüber, warum ausgerechnet ihm diese kosmische Ehre zuteil wird: „Ob über ihm als Nachtwächter eine andere Nacht Wache hielt, mit durchdringender Intelligenz begabt, die ihm den Löwen zu Ermunterungszwecken geschickt hatte, vielleicht aber auch, damit endlich klarer, rücksichtsloser, entschiedener geschrieben wurde, damit er Risiken einging und sein Äußerstes zu Papier brachte?“
Weniger prätentiös ist die Sprache selten. Noch ein Beispiel? Ja? Na gut: „Von der Enthärtung der physischen Wirklichkeit bei unverwandt in die Erscheinung hineinblühendem Sein ging etwas zutiefst Beruhigendes aus.“ So eine halbgare Klugscheißerei habe ich zuletzt in einem Soziologie-Seminar gehört, bevor ich mit wehenden Fahnen das Nebenfach wechselte.
Zwei der Kapitel tragen die sprechenden Titel „Kurzes Zwischenstück darüber, wo die Zuständigkeit des Erzählers endet“ und „Weiteres Zwischenstück, in dem der Erzähler die Zeit um ein Jahr voranschiebt“. Zu Beginn des zweiten heißt es: „Anders als versprochen, meldet sich der Erzähler noch einmal zu Wort.“ Falls das ein Kunstgriff sein soll, hat Lewitscharoff ihn geschickt kaschiert. Mir kommt es vor, als würde mich der Chirurg während der Operation aufwecken und fragen, ob er den Blinddarm ganz entfernen soll oder nur halb oder ob ich stattdessen vielleicht eine Frikadelle implantiert bekommen möchte. Mir ist es sehr recht, wenn ein Autor seine Gedanken über die beste Erzählweise mit sich selbst oder seinem Verlag ausmacht, und mir nicht seine unausgegorenen Ideen vor die Füße kippt. Apropos Erzählweise: Wenn die Geschichte auserzählt ist, führt Lewitscharoff einfach eine neue Figur ein und erzählt ab da von der. Ich komme leider nicht umhin, das plump zu finden.
Natürlich habe ich in den letzten zwei Dritteln die ganze Zeit nach einem Hinweis auf Lewitscharoffs Überzeugungen gesucht. Aber so einfach war es nicht. Ich habe stattdessen das Gegenteil gefunden. „Der Tod hat keinen Wert, das Leben allen“, schreibt sie. Stimmt. Als sie die künstliche Befruchtung geißelte, hatte sie das wohl vergessen.
Was jetzt? Momox-Stapel. Auch wenn der Wertverlust wahrscheinlich dramatisch ist.
Sibylle Lewitscharoff: „Blumenberg“. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 216 Seiten, Taschenbuch, 8.99 Euro.
#8 – Judith Hermann: „Sommerhaus, später“
Provenienz: aus der großen Kollegen-Schenkung
Ungelesen seit: einundzwanzig Monaten
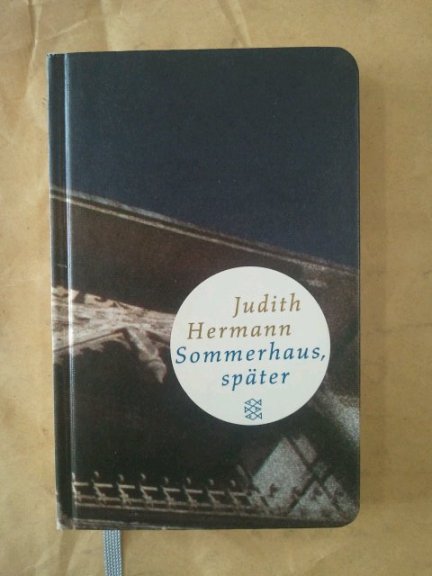 Warum habe ich eigentlich noch nie etwas von Judith Hermann gelesen? Asche auf mein Haupt. Die Verfilmung einiger Geschichten aus „Nichts als Gespenster“ habe ich gesehen, 2007, und ich weiß nur noch, dass sie mir gefallen hat – mehr nicht. Was für eine gnädige Verkürzung. Das sollte einem mit Menschen öfter so gehen.
Warum habe ich eigentlich noch nie etwas von Judith Hermann gelesen? Asche auf mein Haupt. Die Verfilmung einiger Geschichten aus „Nichts als Gespenster“ habe ich gesehen, 2007, und ich weiß nur noch, dass sie mir gefallen hat – mehr nicht. Was für eine gnädige Verkürzung. Das sollte einem mit Menschen öfter so gehen.
Dann war ich noch 2009 bei einer Lesung aus „Alice“ im Münchner Literaturhaus. War toll. Ich hätte also schon viel früher dieses Buch in die Hand nehmen sollen. Womöglich hat mich das Cover abgeschreckt. Die Fischer-Taschenbibliothek ist haptisch und auch optisch sonst ein solches Vergnügen, aber dieses Motiv wurde von der Erstausgabe übernommen und funktioniert als Ausschnitt einfach nicht. Das Buch hat was Besseres verdient!
In Judith Hermanns Kurzgeschichten verändert sich niemandes Leben. Sie bilden Episoden ab, die die Figuren möglicherweise prägen, möglicherweise aber auch nur unwichtige Erinnerungen hinterlassen. In dem Punkt haben sie mit denen von Clemens Meyer wirklich gar nichts gemein. Erfreulicherweise fehlt ihnen dadurch auch jene etwas gewollte Wucht. Ähnlich wie bei Meyer ist nur die Homogenität der Figuren: Alle sind Künstler oder sonstwie Kreative; man arbeitet grundsätzlich schon, nur jetzt gerade nicht. Herrliche Zustände. Dieser Umstand liefert nebenbei tatsächlich ein kleines Sommerferien-Gefühl mit.
Die Autorin ist kurz angebunden, ohne lakonisch zu werden. Das würde ihre Figuren abwerten, und davon ist sie weit entfernt. Ihre Geschichten sind wie ein perfekter Kopfsprung: Man gleitet sanft ins Wasser, schnell hindurch, und kann am anderen Ende des Beckens unbeschadet wieder rausklettern. Aber sie bieten durchaus Gelegenheit, noch ein bisschen darin zu baden.
Das mag trivial klingen, und tatsächlich musste ich eine Weile darüber nachdenken, warum trotzdem jede einzelne Geschichte lesenswert ist: Es sind die komplexen Beziehungen der Figuren. Die junge Frau, die von der Depression ihres Liebhabers fasziniert ist. Der Mann, der die Tochter seines alten Freundes nicht rauswerfen will. Der Adabei, der mit dem Kauf eines Sommerhauses seine Clique zu beeindrucken versucht. Die Frau, die sich in einem sorglosen Urlaub in einen kiffenden Familienvater verliebt. Nichts davon ist weltbewegend, aber alles interessant. Eine solche Leichtigkeit mit Tiefgang zu verbinden, zeichnet Judith Hermann aus.
Was jetzt? Kommt auf den Ehrenplatz neben Alice Munro. (Die muss ich auch bald zu Ende lesen.)
Judith Hermann: „Sommerhaus, später“. Erzählungen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2007. 207 Seiten, gebunden, 9 Euro.