Kategorie: Frankreich
#24 – Jean-Paul Sartre: „La nausée“
Provenienz: Ich kehrte von zwei Monaten Frankreich zurück und überlegte, welches Buch ich nun auf Französisch lesen könnte, um mir die Sprache präsent zu halten. Jemand riet mir zu „La nausée“. Ich habe seltsame Freunde.
Ungelesen seit: 2007
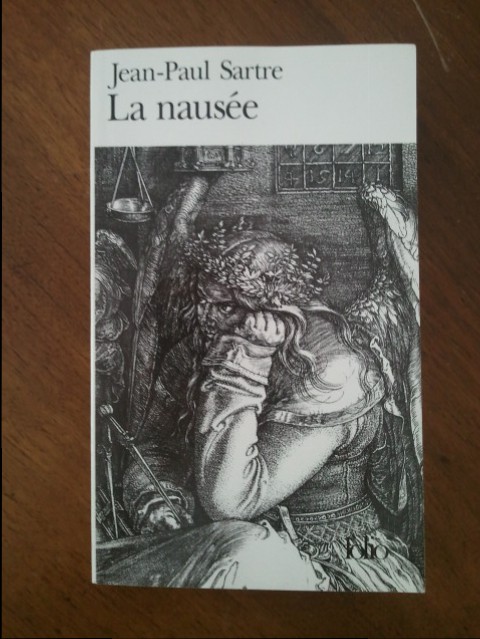 Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Mit den ganz wichtigen und bedeutsamen Werken ist es ja immer so eine Sache. Manche habe ich vorher gefürchtet und dann geliebt. Und bei anderen dachte ich: Das war’s jetzt? Darum machen alle so einen Bohei?
Bei „La nausée“ (der deutsche Titel „Der Ekel“ ist irritierend unzutreffend) trat keine dieser beiden Reaktionen ein. Es war viel schlimmer: Ich war von den ersten Seiten an genervt. Der Erzähler ist Historiker, recherchiert in Bibliotheken herum, fühlt sich aber eigentlich der ganzen Sache nicht recht gewachsen. Ihm fehlt die Neigung seiner Berufskollegen, aus einer einzigen Handlung auf die ganze Geschichte zu schließen. Darum fügt sich das Bild über den Diplomaten Rollebon nicht recht zusammen. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem, sondern: Da ist plötzlich dieses merkwürdige Gefühl, das er vielen Dingen und Menschen gegenüber empfindet. „Ça s’est installé sournoisement, peu à peu ; je me suis senti un peu bizarre, un peu gêné, voilà tout.“ („Es fing unbemerkt an, ganz allmählich; ich fühlte mich etwas seltsam, etwas unbehaglich, das war schon alles.“)
Ab diesem Punkt ergeht der Erzähler sich in Betrachtungen. Und die sind wunderbar geschrieben: Vom Verhalten der Herren, die im Café Karten spielen, über das Aussehen des Wirtes, bis zum Klang der Musik, die er dort hört. Außerdem hat „La nausée“ recht witzige Momente. Als der weitgereiste Erzähler nämlich erklärt, er sei ein hervorragender Erzähler von Anekdoten: „Pour l’anecdote je ne crains personne, sauf les officiers de mer et les professionnels“ – „Bei Anekdoten fürchte ich niemanden, außer Marineoffizieren und Prostituierten“.
Was mich aber unglaublich gestört hat, war die wehleidige Haltung des Erzählers. Ich weiß schon, Hauptwerk des Existenzialismus und alles, aber trotzdem wollte ich ihm dauernd einen Kakao reichen und ihn zum Jammern vor die Tür schicken. Das hat mich selbst überrascht, denn ich mag die etwas wehleidigen Erzähler ja eigentlich, siehe Genazino. Aber mir hat bei Sartre die Selbstironie gefehlt, und ja, es ist durchaus möglich, dass dieses Buch vor Selbstironie strotzt und ich es nicht gerafft habe, weil mein Französisch nicht perfekt ist. Aber ich glaube es eher nicht. Die Ironie, die sich auf die Beobachteten bezieht, habe ich nämlich durchaus mitbekommen. Davon gibt es reichlich, das ist auch durchaus amüsant.
Jedenfalls führt die neue, distanzierte Betrachtungsweise der Welt dazu, dass der Erzähler den Sinn der Existenz anzuzweifeln beginnt. Diese eine Wurzel da im Park, warum genau gibt es die? Könnte es sie nicht auch nicht geben? Warum ist sie diese und nicht eine andere? Ich erinnere mich, mir solche Fragen auch mal gestellt zu haben. Da war ich in der Pubertät und wahrscheinlich selbst ziemlich wehleidig. Also bin ich vielleicht mit der Lektüre einfach nur etwas zu spät dran, in meinem hohen Alter.
Was jetzt? Die Vernunft sagt: Schmeiß weg. Die Eitelkeit sagt: Stell’s ins Regal.
Mal sehen, wer gewinnt.
Jean-Paul Sartre: „La nausée“. Roman. Editions Gallimard, 2007. 250 Seiten, Taschenbuch, 8.80 Euro.
#15 – Guy de Maupassant: „Das Haus Tellier“
Provenienz: Ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie das in mein Regal gelangt ist. Allerdings steht schon wieder der Name meiner Mutter vorne drin. Hm.
Ungelesen seit: Da würde ich nonchalant auf zehn bis fünfzehn Jahre tippen.
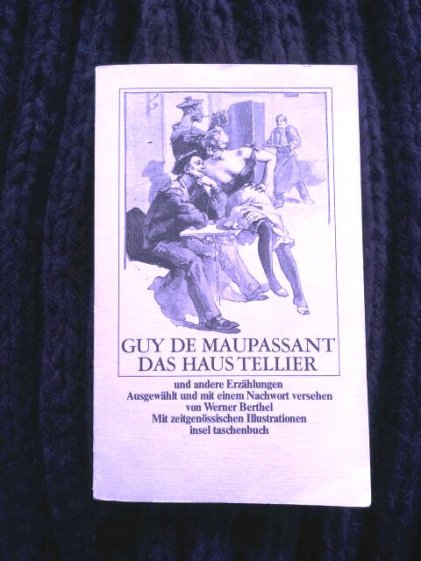 Das Buch steht schon so lange unauffällig bei mir rum und duckt sich immer wieder unter meinen Blicken weg. Diesmal habe ich es endlich in die Hand genommen, weil einer der Blogger meines Vertrauens von Guy de Maupassant geschwärmt hat. Außerdem: Französische Halbwelt, 19. Jahrhundert – irgendwie geht das doch immer. Und dann hat der Autor auch noch einen ähnlich fantastischen Vornamen wie Laclos, nämlich Henri-René-Albert-Guy. Das wäre doch mal eine schöne Anregung für diese Muttis, die in Onlineforen nach ungewöhnlichen Babynamen suchen und dann so etwas wie Gedanion erwägen. Aber ich schweife ab.
Das Buch steht schon so lange unauffällig bei mir rum und duckt sich immer wieder unter meinen Blicken weg. Diesmal habe ich es endlich in die Hand genommen, weil einer der Blogger meines Vertrauens von Guy de Maupassant geschwärmt hat. Außerdem: Französische Halbwelt, 19. Jahrhundert – irgendwie geht das doch immer. Und dann hat der Autor auch noch einen ähnlich fantastischen Vornamen wie Laclos, nämlich Henri-René-Albert-Guy. Das wäre doch mal eine schöne Anregung für diese Muttis, die in Onlineforen nach ungewöhnlichen Babynamen suchen und dann so etwas wie Gedanion erwägen. Aber ich schweife ab.
Maupassant stammte aus einer alten Adelsfamilie, fühlte sich aber thematisch zum einfachen Volk hingezogen. Die titelgebende und zugleich berühmteste Erzählung handelt von einem Etablissement, in dem unten die Matrosen und oben die Honoratioren der Stadt bedient werden. Bei schönem Wetter machen alle Damen gemeinsam einen Ausflug ins Grüne. Sie sind im Ort nicht übermäßig angesehen, aber das ändert sich, als sie aufs Land fahren, um der Kommunion des Neffen der Wirtin beizuwohnen. Dort sind sie die schicken Städterinnen. Ein ganz reizvoller Gegensatz.
Auch die etwas feinere Gesellschaft kommt in dieser Sammlung vor – aber stets hat vor allem das Weibsvolk Dreck am Stecken. Es wirkt beim Lesen nicht einseitig oder gar redundant, aber Maupassant exerziert alle möglichen Situationen durch, wie eine Frau zur Betrügerin werden könnte: um ihrem Mann den ersehnten Orden zu verschaffen, um trotz vier unehelicher Kinder geheiratet zu werden, oder um an Geld zu kommen und dabei denselben Liebhaber wie eh und je zu behalten. Ja, so sind wir, wir zügelloses, schamloses Geschlecht! (Zur akustischen Untermalung geht’s hier.)
Das ist alles ganz zauberhaft, immer mal wieder amüsant und auch zu Herzen gehend. Was mir schrecklich fehlte, war die sprachliche Strahlkraft. Es mag an der Übersetzung gelegen haben – oder daran, dass Maupassant seinen Ausflug in niedere Gefilde mit einer relativ neutralen Sprache ausgleichen wollte. Meinetwegen hätte es jedenfalls deutlich operettenhafter ausfallen können. Aber das geht mir ja eigentlich mit dem ganzen Leben so.
Was jetzt? Es wandert zurück ins mütterliche Regal.
Guy de Maupassant: „Das Haus Tellier“. Erzählungen. Aus dem Französischen von Helmut Bartuschek und Karl Friese. Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main 1977. Taschenbuch, 328 Seiten, vergriffen.
#6 – Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“
Provenienz: Dieses Buch habe ich mir vor einem Toskana-Urlaub mit Freundinnen gekauft. Hatte herrliche Visionen davon, wie ich es am Pool liegend lesen würde. Es stellte sich aber heraus, dass meine Freundinnen noch bessere Unterhaltung bieten.
Ungelesen seit: knapp zwei Jahren
Der vollständige Name des Autors lautet Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, und alleine das nimmt mich schon für ihn ein. Seine Familie war frisch in den Adelsstand erhoben, als er geboren wurde. Der Mann war ein klassisches One-Hit-Wonder: 1782 schrieb er seinen einzigen großen Erfolg „Gefährliche Liebschaften“, im Original „Les Liaisons dangereuses“. Der französische Titel ist insofern treffender, als nicht nur Liebschaften gefährlich sind, sondern auch die Allianzen, die die Figuren eingehen.
Aber der Reihe nach: Die Welt dieses Romans teilt sich anfangs relativ klar ein in Gut (interessanterweise dem neuen Adel zugehörig, wie der Autor) und Böse (alter Adel). Das ist ja immer erfreulich, weil leicht zu erklären. Auf der einen Seite stehen die tugendhafte Madame de Tourvel, deren Gatte für längere Zeit im Ausland weilt, und die junge Cécile de Volanges, deren Mutter sie gerade aus der Klosterschule geholt hat, um sie mit dem Grafen Gercourt zu verheiraten. Zwei wirklich brave Mädchen. Dann gibt es noch Danceny, der Cécile Musikunterricht gibt. Die beiden verlieben sich ineinander, aber ihre Beziehung bleibt trotz aller Liebesschwüre unschuldig.
In der Ecke der Herausforderer: der Vicomte de Valmont, ein bekannter Frauenverführer und Tunichtgut, der sich zum Ziel gesetzt hat, Madame de Tourvel zu verführen. An seiner Seite kämpft die Marquise de Merteuil, die für Cécile de Volanges eine mütterliche Freundin ist und alles daran setzt, das junge Mädchen noch vor der Hochzeit moralisch zu Fall zu bringen. Denn der Graf Gercourt hat die Marquise einmal verlassen und ist seitdem ihr Erzfeind. Deshalb trachtet sie danach, seine jugendliche Braut zu verderben.
„Gefährliche Liebschaften“ ist ein Briefroman, und wenn man anderen Büchern vorwirft, sie seien konstruiert, so muss das hier als Kompliment gelten. Laclos hat zwei Ebenen geschaffen, die einander unterstützen: In den Briefen der Bösen an die Guten ist alles eine einzige Heuchelei; in den Briefen der Bösewichter untereinander legen sie ihre Machenschaften und niederen Beweggründe offen. Diese Briefe bieten immer wieder Überraschungen – und auch die Durchtriebenheit und fiesen Kniffe nötigten mir Respekt ab.
Dafür habe ich am Anfang immer mal wieder quer gelesen, denn die Liebenden machen mit schöner Ausdauer immer einen Schritt vor und einen zurück. Die Briefe sind voller Beteuerungen, Vorwürfe und unnötiger Dramatisierungen. Vielleicht muss man das Buch mit Anfang zwanzig lesen, in einer romantischen Phase, um dieses ganze Geblubber nicht über zu bekommen: „Ich werde mir immer einreden, Ihr Herz sei fühllos. Ich werde mir sogar Mühe geben, Sie nicht mehr so oft zu sehen, und halte jetzt schon Ausschau nach einem triftigen Vorwand. Wie? Ich soll die liebe Gewohnheit aufgeben, Sie tagtäglich zu sehen? Ach, wenigstens werde ich nie aufhören, mich danach zu sehnen! Ein Unglück ohne Ende wird der Lohn für die zärtlichste Liebe sein.“
Ächz. Nur die Briefe von Valmont und der Marquise, die sich über die romantischen Dummheiten der anderen mokieren, haben mich das ertragen lassen.
Das größte Vergnügen allerdings bieten die ausgefeilten Psychogramme, die das Buch zeichnet. Die Masken, mit denen alle hantieren, werden nach und nach abgerissen – und nicht immer ist das, was zum Vorschein kommt, schlecht. Trotzdem sind am Ende natürlich alle dem Elend geweiht. Es mag mich nicht in ein weiches Licht setzen, aber mich hat das zufrieden gemacht: Die Romantiker haben mich zuvor doch einigermaßen genervt, und die Intriganten haben es auch nicht besser verdient.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Ich suche noch einen netten Nachbarn für das Buch – vielleicht Jane Austen.
Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“. Roman. Aus dem Französischen von Walter Widmer. Harenberg, Dortmund 1986. 346 Seiten, gebunden, in dieser Ausgabe vergriffen.
#1 – Milan Kundera: „Die Identität“
Provenienz: geschenkt bekommen von Kollegen
Ungelesen seit: anderthalb Jahren
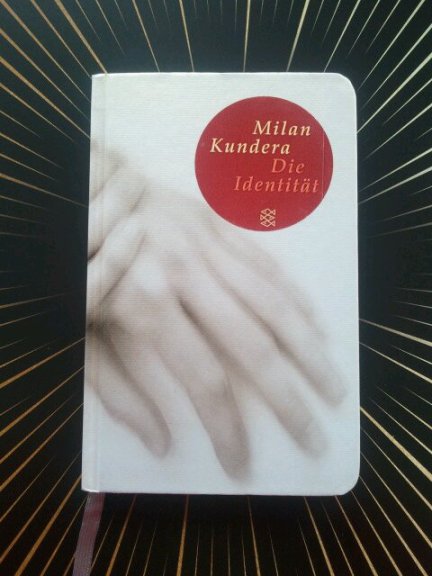 Milan Kundera hat mich schon zwei Mal aufgeklärt. Das erste Mal ganz klassisch: Meine Eltern stellten die Erwachsenenbücher weit oben ins Regal, und ich stieg von da an regelmäßig auf einen Stuhl. So fiel mir „Das Buch vom Lachen und vom Vergessen“ in die Hände, das ein paar ziemlich explizite Szenen enthält und für eine Zwölfjährige wirklich keine Fragen mehr offen lässt.
Milan Kundera hat mich schon zwei Mal aufgeklärt. Das erste Mal ganz klassisch: Meine Eltern stellten die Erwachsenenbücher weit oben ins Regal, und ich stieg von da an regelmäßig auf einen Stuhl. So fiel mir „Das Buch vom Lachen und vom Vergessen“ in die Hände, das ein paar ziemlich explizite Szenen enthält und für eine Zwölfjährige wirklich keine Fragen mehr offen lässt.
Beim zweiten Mal war ich achtzehn Jahre alt und meinte natürlich, schon alles über Männer zu wissen. Bis „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ mich erneut aufklärte: Männer pinkeln ins Waschbecken! Also, nicht immer, aber manche, manchmal. Meine Fassungslosigkeit war groß. Der Neid auf solch anatomische Flexibilität ebenfalls.
Ich war also auf alles vorbereitet, als ich den dritten Kundera in die Hand nahm. Es ist eher ein Bändchen, sogar in dieser knuffigen Fischer-Bibliothek. Liest sich also schnell, was meist ja eher für ein Buch spricht.
Chantal und Jean-Marc leben schon seit einigen Jahren zusammen, aber nun sieht Chantal sich rapide altern. Sie ist deprimiert und sagt ihrem Freund, die Männer drehten sich nicht mehr nach ihr um. Das trifft zwar nicht den Kern ihres Problems, aber einmal ausgesprochen, mag sie die Worte nicht zurücknehmen. Also schreibt er ihr heimlich anonyme Liebesbriefe.
Bald kommt Chantal dahinter und ist wütend. Denn ihr Gefühl, wieder begehrt zu sein, hat dem Paar einen erotischen Frühling beschert, dessen Ursache Jean-Marc natürlich durchschaut. Die beiden beobachten einander argwöhnisch, bis es zum Eklat kommt: Chantal setzt sich nach London ab, trifft absurderweise auf dem Weg dorthin ihre gesamte Kollegenschaft und landet auf einer Sexparty, die in ihr plötzlich die Sehnsucht nach Jean-Marc schürt.
So weit ist das alles ganz fein. Melancholisch, hoffnungsvoll und feinfühlig. Aber dann kommt ein Schluss von der Art, die viele Leser verärgert – auch mich. Die Art, deretwegen man dem Autor Faulheit, Feigheit, eine Inspirationslücke oder alles zusammen vorwerfen möchte, selbst wenn er Milan Kundera heißt.
Und der aufklärerische Schock? Na ja, beinahe. Chantals Chef referiert: „Übrigens, man hat das Leben eines Fötus im Bauch seiner künftigen Mama gefilmt. In einer akrobatischen Stellung, die wir nicht nachmachen könnten, fellationierte er sein eigenes winziges Geschlechtsorgan.“
Das war definitiv mein WTF des Tages. Ihr könnt euch die Mühe und den peinlichen NSA-Eintrag sparen: Ich hab es schon gegoogelt und absolut nichts gefunden, was diese Behauptung belegen würde. Immerhin: Das lässt hoffen, was die ins Waschbecken pinkelnden Männer angeht. Vielleicht war das auch Quatsch. Aber das google ich jetzt nicht auch noch.
Was jetzt? In meinem Regal hat dieses Buch keine große Zukunft. Wahrscheinlich verleihe ich es erst mal an einen mir bekannten Kundera-Anhänger. Ob er will oder nicht.
Milan Kundera: „Die Identität“. Aus dem Französischen von Uli Aumüller. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2006. 170 Seiten, gebunden, 9 Euro.
