Getagged: Roman
OMG.
 Es ist da! Mein Buch ist fertig, und dafür, dass es das dritte ist, bin ich immer noch erstaunlich hysterisch. Verlegenheitsanfälle, Schnappatmung, nervöses Gekicher – alles dabei. Allerdings geht mir das eh fast immer so, wenn ich Bilder besonders niedlicher Pinguine sehe. Falls noch jemand der Pinguinliebe verfallen ist: Ich hab da was für euch.
Es ist da! Mein Buch ist fertig, und dafür, dass es das dritte ist, bin ich immer noch erstaunlich hysterisch. Verlegenheitsanfälle, Schnappatmung, nervöses Gekicher – alles dabei. Allerdings geht mir das eh fast immer so, wenn ich Bilder besonders niedlicher Pinguine sehe. Falls noch jemand der Pinguinliebe verfallen ist: Ich hab da was für euch.
Ach ja, das Buch hat natürlich nicht nur dieses superflauschige Cover, sondern auch einen Inhalt. Jawohl! „Liebe mich, wer kann!“ erzählt die Geschichte von Greta: Sie ist frisch getrennt von ihrem Mann Erik, hat sich in Zynismus geflüchtet und soll sich eine Werbekampagne über die große Liebe ausdenken. Ihre beste Freundin will sie aufheitern, aber ausgerechnet das von ihr vorgeschlagene Lachtraining stürzt Greta ins nächste emotionale Drama.
Über die Trennung kommt Greta auch nicht wirklich hinweg: Nach ein paar Gläsern Wein schreibt sie Erik regelmäßig böse Mails, kann sich aber am nächsten Morgen an nichts erinnern. Kündigt sich so der vollkommene Irrsinn an? Der Psychotherapeut, den sie deswegen aufsucht, wirkt jedenfalls noch verrückter als sie selbst. Aber Greta gibt nicht auf. Irgendwo muss ja das Glück auf sie warten – doch es zu erkennen, das ist gar nicht so einfach.
Übrigens schreibe ich sehr liebevolle Widmungen, wie die hineingedruckte beweist. Falls es jemand signiert verschenken möchte: einfach melden!
Erschienen bei Blanvalet, 320 Seiten, Taschenbuch, 8,99 €, hier geht’s zum Buch.
#45 – Nora Roberts: „Töchter des Windes“
Provenienz: vom Verlag zugeschickt bekommen
Ungelesen seit: fünf Monaten
Zufällig veröffentliche ich beim selben Verlag wie Nora Roberts, wo man um meine kleine Schwäche für sie weiß und mir deshalb ein Paket mit einer kleinen Auswahl ihres gewaltigen Œuvres gepackt hat. Falls ihr euch schon ewig fragt, wer den Scheiß eigentlich liest: ich. Ich les den Scheiß. Dafür brauche ich aber immer gute Gründe. Eine schwere Erkältung etwa bringt mich auf genau das richtige intellektuelle Level. Diesmal war es die Einrichtung und Renovierung meiner neuen Wohnung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Derzeit komme ich abends von der Redaktion nach Hause, zieh das Röckchen aus, die Handwerkerhose an und die Werkzeugkiste hinter mir her.
 Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Die Geschichte, tja. Kennste eine, kennste alle: Brianna führt eine Pension in Irland und ist eine rechtschaffene Unschuld vom Lande, wobei Unschuld auch noch ganz wörtlich zu verstehen ist. Dann mietet sich Grayson für einige Monate bei ihr ein, ein Amerikaner, der in der Abgeschiedenheit einen seiner blutrünstigen Thriller schreiben will. Er hat natürlich eine düstere Vergangenheit, Heimkind, Straßenjunge, Kleinkrimineller, ist jetzt aber vollkommen geläutert und noch dazu scheißreich, was der braven Brianna selbstverständlich überhaupt nichts bedeutet. Man kommt sich näher, sie heilt seine kaputte Seele mit der Kraft ihrer Liebe. Bin ich die einzige, die sich an „Fifty Shades of Grey“ erinnert fühlt? Es hat was davon, war aber erstens lange vorher da und ergeht sich zweitens eher in Kerzenschein-und-Flanellnachthemd-Erotik. Keine Peitschen, nirgends.
Was genau daran mich dazu treibt, bis zum Ende zu lesen? Ehrlich, ich hab keine Ahnung. Man weiß von Anfang an, wie es ausgeht, selbst die zweite große Krise ist völlig vorhersehbar. Das ist bei Genre-Romanen ja oft so, aber bei Nora Roberts hat man schon gelegentlich den Eindruck, sie tauscht von Buch zu Buch nur die Namen, den Schauplatz und die Berufe ihrer Figuren aus. Übrigens ist dies Teil zwei einer Trilogie, also nehme ich das mit dem Schauplatz zurück, denn es spielt alles in diesem Umfeld. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Wenn man sein Gehirn mal so richtig ausknipsen will, ist das perfekt. Als Kind hab ich immer wieder dieselbe Kasperleplatte gehört, wenn ich krank war, heute sind es eben leicht variierte Kitschromane. (Ja, da steht Platte. SCHALLPLATTE. So alt bin ich.)
Was jetzt? Ich verstecke es irgendwo im Bücherregal und deklariere es als Recherche.
Nora Roberts: „Töchter des Windes“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Uta Hege. Blanvalet Verlag, München 2014 (drölfzigste Auflage). 477 Seiten, Taschenbuch, 9.99 Euro.
#44 – Jonathan Franzen: „Unschuld“
Provenienz: Der Mann überreichte es mir, nachdem er mich vorher kaltblütig mit „Freiheit“ angefixt hatte.
Ungelesen seit: Etwa zwanzig Minuten. Ich bin wirklich angefixt.
 Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Der Titel rührt vom Namen der Protagonistin her, Purity, genannt Pip. Eine junge Frau mit widerständigem Geist, haufenweise Studienschulden und einer anstrengenden Mutter. Pip hasst ihren Job, wohnt in einem besetzten Haus und ist unglücklich in einen der Mitbewohner verliebt. In dieser desolaten Situation erhält sie das Angebot, nach Bolivien zu reisen und für eine Organisation zu arbeiten, die entlarvende Regierungsdokumente ebenso online stellt wie Zahnarztskandälchen. Sie fährt hin, sie lernt einen Mann mit zwei Gesichtern kennen, und sie findet im Anschluss heraus, wer ihr stets totgeschwiegener Vater ist. Ich unterschlage jetzt mal sämtliche Details, ihr sollt es schließlich selbst lesen.
Franzen zeichnet seine Figuren sehr plastisch, und er nimmt sich viel Zeit dafür. Über jedermanns Vergangenheit erfahren wir viel, es wird ausgiebig erzählt, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Das ist super, das hätte ich fürs richtige Leben auch gerne. Jemanden, der neben mir hergeht und Dinge sagt wie: „Dein neuer Kollege hat als Kind lange ins Bett gemacht, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hat. Er ist zutiefst unsicher, deshalb wirkt er wie ein arroganter Saftsack.“ Wäre das schön. Und so praktisch! Mein einziger Kritikpunkt an der Geschichte ist, dass mir die Kombination „Alter Mann trifft junge Frau, doch nach ein paar Jahren wird es zäh“ ein bisschen zu oft in leichten Variationen vorkam.
Aber. ABER! Die Übersetzung. Es ist das Grauen. Tut mir leid. Denn eigentlich fallen durchaus wunderschöne Sätze in „Unschuld“. Diese zum Beispiel:
Als arbeitende Journalisten in einer Studentenschaft, die sich nach Studentenmanier vergnügte, erreichten meine Freunde und ich ein Selbstgefälligkeitsniveau, wie es mir erst wieder unterkommen sollte, als ich Mitarbeiter der New York Times kennenlernte. Natürlich hatten wir alle einen Nougatkern der Unschuld, aber jeder prahlte mit seinen sexuellen Großtaten an der Highschool, und dass meine Freunde womöglich logen – ich tat es ja schließlich auch –, dämmerte mir nie.
Nougatkern der Unschuld, hach. Und jetzt kommen wir zu den Negativbeispielen. Es fängt damit an, dass Pip und ihre Mutter besonders geruchsempfindlich sind. „Smell is hell“, sagen sie im amerikanischen Original. Und im Deutschen? „Geruch ist Fluch.“ Waaaahhh! Das reimt sich nicht! Nicht mal im Ansatz! Das macht mich völlig fertig. Was war die Alternative, wenn die Übersetzer das für die beste Lösung hielten? „Riechen ist Siechen“? „Gestank ist Punk“? „Odeur macht’s mir so schwör“? Halten wir fest: Man hätte das einfach gar nicht übersetzen müssen. Schließlich sind auch ganze Sätze auf Spanisch nicht übersetzt. Man versteht das schon, Himmelherrgott.
In Relation dazu ist der Rest Kleinkram, über den man beim Lesen trotzdem stolpert. „Er rümpfte die Brauen“ etwa missfiel mir außerordentlich. Außerdem schreibt der Godfather of Internetenthüllungen in Mails an Pip dauernd LOL. LOL. Wie so ein Teenager anno 2005. „Ihre Mail ist LOL“ – das ist nicht nur miese Grammatik, sondern auch noch peinlich. ROFLCOPTER hätte ich immerhin noch als Ironie durchgehen lassen.
Sehr seltsam mutet auch die Beschreibung an, wie bei der Arbeit am Computer „alle Frauen […] mausten und klickten“. Ich kenne mausen durchaus als Verb, aber in dieser Bedeutung ist es mir noch nie untergekommen. Außerdem kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, die bedeutungsarme Tätigkeit des bloßen Umherschiebens der Maus, bis man wieder eine ihrer Tasten betätigt, habe überhaupt kein eigenes Verb verdient. Diese Stellen haben mich fürchterlich geschmerzt, aber sie können das Buch nicht ruinieren. Ein Glück. Lest es.
Was jetzt? „Die Korrekturen“. Ganz klar.
Jonathan Franzen: „Unschuld“. Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Hamburg 2015. 832 Seiten, gebunden, 26.95 Euro.
#43 – Per Petterson: „Pferde stehlen“
Provenienz: Geschenk zum 30. Geburtstag
Ungelesen seit: Ja, ja. Ich will nicht drüber reden. Pfff.
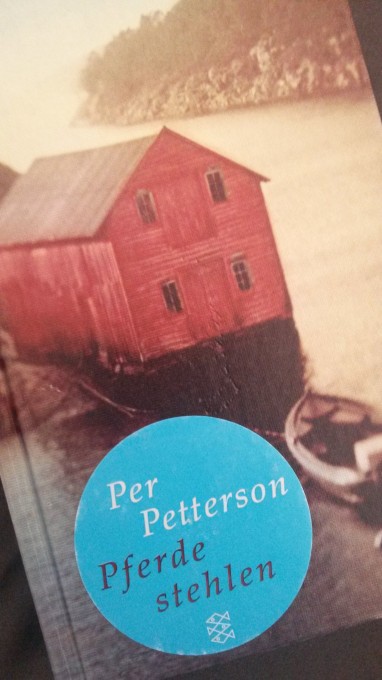 Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Herrje, hat mich dieses Buch genervt. Es ist bei seinem Erscheinen heftigst gelobt worden, aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Also: Der 67-jährige Witwer Trond zieht in eine Hütte nach Ostnorwegen. In der Gegend hat er früher mit seinem Vater ein paar Sommer verbracht. In einem dieser Sommer ist etwas Schlimmes geschehen; ein Kind kam ums Leben. Außerdem scheint der Vater ein, zwei Geheimnisse vor seiner Familie gehabt zu haben. (Spoiler: Jetzt auch nicht die allerüberraschendste Sorte.)
Jedenfalls erzählt Per Petterson dann erstmal ausgiebig davon, wie sie früher Baumstämme umgesägt haben. Wie sich das anfühlt in den Muskeln, wie das riecht, wie man schwitzt, wie hungrig man danach ist und wie stolz. SEI-TEN-WEI-SE. Okay, ich lebe in der Großstadt, aber ich kann immerhin Holz hacken und besitze eine Stichsäge – wenn mich das nicht interessiert, also so wirklich null, nada, wen interessiert es dann?
Aber das war ja erst die vergangene Zeitebene. Wir haben ja auch noch eine heutige, in der Trond öde Spaziergänge mit seinem Hund macht, in seinem Nachbarn einen alten Bekannten wiedererkennt und – ihr ahnt es bereits – im Hof eine vom Sturm umgehauene Birke zersägt. Mit Hilfe des Nachbarn, weil Gemeinschaft unter Männern und so, bla bla. Wie toll der Nachbar mit der Kettensäge umgeht, beeindruckend.
Vielleicht könnte man aus diesen Passagen das Editorial des Programms für die nächste Lumberjack-Weltmeisterschaft schnitzen. Aber als Roman, pardon, haben sie mich ins Bodenlose gelangweilt. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht deep genug, den Hintersinn zu erkennen. Wer weiß.
Was jetzt? Will jemand? Ich würde es verschenken. An jemanden mit Lumberjack-Fetisch vielleicht.
Per Petterson: „Pferde stehlen“. Roman. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Juni 2009. 335 Seiten, gebunden, 9 Euro.
#42 – Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“
Provenienz: Geschenk zum Dreißigsten (schon wieder! Und immer noch!)
Ungelesen seit: Ja, ja, drei Jahren. Hmpf.
 Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Jetzt aber ist Katarina schwanger von ihrer Sommerliebe Jack, einem Amerikaner, der zu Hause Frau und Kinder hat. Und sie ist auf dem Weg zu ihrer Mutter, um ihr davon zu erzählen: dass sie das Kind will, aber den Mann nicht, obwohl er ihr mehr bedeutet als alle anderen davor. Das Verhältnis zur Mutter ist herzlich, aber nicht unbelastet – als Katarina klein war, wischte sie ihrer Mutter das Blut aus dem Gesicht, wenn der Vater sie wieder krankenhausreif geschlagen hatte. Auch Jack hat eine ähnliche Familiengeschichte. Als Katarina von ihrem Kurzurlaub bei der Mutter zurückkehrt, erwartet er sie – und prügelt auf sie ein, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Gibt es familiäre Muster, aus denen wir nicht ausbrechen können? Zieht Gewalt automatisch Gewalt nach sich? Das sind die großen Fragen, die „Geliebte Tochter“ aufwirft. Katarina wird nach Jacks Schlägen von ihrem Bruder Olof und dessen Frau Erika gesund gepflegt und beginnt, gemeinsam mit ihrer Mutter ihre traumatischen Kindheitserinnerungen aufzuarbeiten. Die Nähe zur Familie tut ihr gut, aber gleichzeitig ist sie eifersüchtig auf die besondere Beziehung ihrer Schwägerin zu ihrer Mutter und empfindet sich als Last, was sie durch finanzielles Engagement auszugleichen sucht.
Marianne Fredriksson widmet sich Katarina, aber sie verliert auch Jack nicht aus den Augen. Er geht zurück nach Amerika, geplagt von Schuldgefühlen, und stürzt dort vollkommen ab, ehe ausgerechnet sein Vater, der früher selbst zugeschlagen hat, ihn auffängt.
Diese ganzen menschlichen Dramen, die sich da aneinander reihen, sind ganz klug und schlicht erzählt. Überhaupt ist der Tonfall sehr geradeheraus, stellenweise in der Übersetzung für meinen Geschmack sogar etwas zu lakonisch geraten. Ein paar inhaltliche Dinge sind ebenfalls irritierend: Olof und Erika haben zwei Jungs aus Vietnam adoptiert, und Jack findet es völlig abgefahren, dass sie „chinesische Kinder“ haben. Der Typ ist New Yorker, sollte ihn ethnische Vielfalt wirklich so aus der Bahn werfen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ach ja, und dann verliebt Katarina sich wieder, diesmal ernsthaft, aber der Mann ist offensichtlich ein Filou. Und was sagt unsere starke, schöne Schwedin da zu ihrer Mutter über ihn? „[Er] ist ein richtiges Hänschen klein, das in die weite Welt hineingeht und sich gern auf sein Mütterlein besinnt.“ Mit dem Mütterlein meint sie sich als seine Lebenspartnerin. Boah. Im Ernst jetzt, Mädels? Ich dachte, wir wären darüber hinweg, Männer als schwachsinnige Kinder darzustellen.
Was jetzt? Das Buch darf bleiben. Wer weiß, vielleicht muss ich mich dem Männerbild ja eines Tages anschließen.
Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“. Roman. Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2010. 368 Seiten, gebunden, 8.90 Euro.
#41 – Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“
Provenienz: selbst gekauft, weil: Wolf Haas!
Ungelesen seit: ein oder zwei Jahren
 Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Auch hier möchte ich nicht zu viel der phantastischen kleinen Ideen verraten, die in diesem Buch stecken. Nur die erste, die wie eine Einführung wirkt: Benjamin Lee Baumberger, der Protagonist und beste Freund des Erzählers, irrt durch einen Markt in England, wo er sich gerade unglaublich in eine Burgerverkäuferin verliebt hat. Er sucht sie, um sie abzuholen und den Abend mit ihr zu verbringen, doch er geht zuerst geradeaus und biegt dann links ab – und der Text, eine einzelne Zeile auf der Seite, macht dasselbe.
Das ist natürlich ganz schön verspielt und schreckt wahrscheinlich den Klassiker-Leser eher ab. Ich fand es großartig. Diese Seiten machen mehr aus der Geschichte, es ist wie ein kleines Sketchbook. Apropos Geschichte, da war doch was. Also: Wenn Benjamin Lee Baumberger sich verliebt, bricht fast immer in seiner Nähe eine Seuche aus. BSE, Vogelgrippe, Schweinepest: Er ist immer mittendrin statt nur dabei. Hier schlägt sich die Liebe der Österreicher zum ständigen Thematisieren von Krankheiten, diese seltsame Volkshypochondrie, literarisch aufs Schönste nieder. (Ja, das ist ein Pauschalurteil. Liebe Österreicher ohne hypochondrische Anwandlungen: Meldet euch gerne bei mir und beweist mir, dass ich falsch liege.)
Zum Glück verliebt Benjamin Lee sich zwischenzeitlich sehr lange nicht: Er ist in festen Händen. Das ist die Phase, in der der Erzähler sich mit ihm anfreundet und sich auch gleich noch in seine Frau verguckt. Als Benjamin Lee sich in Peking die Vogelgrippe einfängt und mit einer Holländerin vorübergehend verschwindet, versucht der Erzähler die besorgte Ehefrau zu trösten, löst aber unabsichtlich die finale Ehekrise aus.
Ganz, ganz wunderbar fand ich auch, dass Haas statt atmosphärischen Beschreibungen oft einfach nur [LONDON, FRISUREN, MODE] oder [BESCHREIBUNG DER BRÜCKE] einfügt. Diese Stellen kenne ich als Autorin nur zu gut, aber die Chuzpe, daraus einen Running Gag zu machen, muss man erst mal haben. Meine Lieblingsstelle ist [PARKATMOSPHÄRE EINFÜGEN. BÄUME UND LEUTE ETC. EVTL. VON BRUNO SCHREIBEN LASSEN. ODER VON HELGA, FALLS SIE SCHON WIEDER DA IST].
Das hat mich ein bisschen an diesen Tweet erinnert:
Was jetzt? Als nächstes muss es der Mann lesen, und dann werde ich es etwa drölfzigtausend Mal nachkaufen und verschenken.
Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“. Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 239 Seiten, gebunden, 19.90 Euro.
#40 – Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“
Provenienz: Geschenkt bekommen.
Ungelesen seit: drei Jahren
 Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Jedenfalls wirkt „Die Frau des Zeitreisenden“ von außen fröhlich, geradezu trivial. Das hat der Roman mal wieder dem Klappentext zu verdanken: „Clare fällt aus allen Himmeln, jedes Mal aufs Neue, wenn Henry vor ihr steht. […] Seine Zeitreisen sind das brennende Geheimnis, das Henry und Clare mit jeder Trennung noch inniger vereint.“ Brennendes Geheimnis? Geht’s noch? Groschenroman, ick hör dir trapsen. Solche Sätze hat das Buch nicht verdient!
Tatsächlich handelt es sich um eine romantische Liebesgeschichte, die erstaunlich wenig creepy ist, obwohl sie alle Zutaten hätte. Schließlich besucht der Zeitreisende Henry seine Frau Clare, als jene noch ein Kind und später ein junges Mädchen ist, das ihn unbedingt verführen möchte. Das klappt erst spät, dann allerdings haben die beiden dauernd Sex, unentwegt, es ist fast etwas redundant, aber gut, wir halten fest: Sie begehren einander sehr.
Und dann wird es heikel. Ich kann leider nicht allzu viel verraten, jedenfalls wird diese fröhliche, beseelte und leicht paranormale Liebesgeschichte ganz langsam ausgebremst. Es deutet sich an, aber weil ich das überhaupt nicht glauben mochte, habe ich natürlich doch bis zum Schluss gelesen. Hätte ich das doch mal besser gelassen.
Romantiker! Lest das Buch, klappt es in der Mitte zu, denkt euch irgendwas von „Happily ever after“ und geht einen Tee trinken. Lest nicht weiter. Ehrlich jetzt, hört auf meinen Rat, ich meine es nur gut.
Und für jene von euch, die eine Axt suchen für das gefrorene Meer in sich: Dieses Buch ist aber so was von eine Axt. Tretet beiseite, wenn die Späne fliegen.
Was jetzt? Ich behalte es, aber das kommt in die „Handle with care“-Ecke.
Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2004. 825 Seiten, geb., 10 Euro.
#35 – Doris Lessing: „Shikasta“
Provenienz: Jemand sortierte es aus, ich schaute empört, führte Doris Lessings Literaturnobelpreis ins Feld und adoptierte es. Fataler Fehler.
Ungelesen seit: etwa drei Jahren
 Dies ist das erste Buch des Blogprojekts, das ich abgebrochen habe. Weil ich mich kolossal langweilte und mir meine Lebenszeit zu schade war. Fun fact: „Shikasta“ ist nur der erste Band eines fünfteiligen Zyklus. Ein Umstand, den ein mir nahestehender Herr mit den Worten kommentierte: „Poah. Autoren sollten einfach nicht so alt werden.“
Dies ist das erste Buch des Blogprojekts, das ich abgebrochen habe. Weil ich mich kolossal langweilte und mir meine Lebenszeit zu schade war. Fun fact: „Shikasta“ ist nur der erste Band eines fünfteiligen Zyklus. Ein Umstand, den ein mir nahestehender Herr mit den Worten kommentierte: „Poah. Autoren sollten einfach nicht so alt werden.“
Zu diesem Zyklus wurde Lessing nach eigenen Angaben von der islamischen Mystik und der Weltsicht des Sufismus inspiriert, aber das muss man schon wissen, um es zu bemerken. Schließlich gibt es asketisch-spirituelle Anklänge auch in zahlreichen anderen Werken. Leider werde ich nicht mehr erfahren, ob es bei Lessing später deutlicher zutage tritt. Vielleicht geht es ja in den anderen Bänden total rund. Und vielleicht sogar in den dreihundert Seiten dieses Buches, deren Lektüre ich beim besten Willen nicht mehr auf mich nehmen werde. Bisher allerdings ist das alles äußerst verquast. Übrigens habe ich euch den vollständigen Titel bisher vorenthalten, das holen wir gleich mal nach:
Canopus im Argos: Archive
Btr.: Kolonisierter Planet 5
Shikasta
Persönliche, psychologische und historische Dokumente zum Buch von JOHOR (George Sherban)
Abgesandter (Grad 9)
87. Periode der letzten Tage
Man ahnt schon: Science Fiction. Space Fiction gar, wie Lessing das nennt, die sich schon im Vorwort mit der Erzählung einer Anekdote bei mir unbeliebt gemacht hat. Sie beschreibt, wie sie zum Vortrag bei einer Universität geladen war und dort sagte, Space Fiction und Science Fiction bildeten „den originellsten Zweig der heutigen Literatur“, seien „einfallsreich und witzig“ und hätten auf alle möglichen anderen Werke „belebend gewirkt“. Die literarische Welt sei zu tadeln, weil sie das nicht hoch genug schätze. Dass eine Professorin zu widersprechen wagte, quittiert Lessing mit den Worten, jene habe sich „wohl zu lange von Akademiens keuschen Früchten genährt“. Das war mir als Eigenwerbung einfach zu plump. Schade, wenn der Leser die Autorin für arrogant und selbstgerecht hält, ehe er zum eigentlichen Roman kommt.
Tatsächlich bin ich kein großer Science-Fiction-Fan, und damit mir ein Werk aus diesem Genre gefällt, muss es genau das sein, was Lessing beschreibt: witzig oder einfallsreich, und mit einfallsreich meine ich, dass die Welt, die darin erschaffen wurde, eine innere Logik besitzt. Leider habe ich genau das bei Lessing schmerzlich vermisst. Es geht um den Planeten Shikasta, der unter dem Protektorat des Verbundes Canopus steht (und der Erde übrigens frappierend ähnelt). Canopus möchte die Entwicklung der menschenähnlichen Lebewesen beschleunigen und siedelt deshalb Riesen an, die die Menschen unterstützen. Doch dann kommt der Planet wegen kosmischer Umwälzungen aus dem Gleichgewicht. Außerdem greift ein Schurkenplanet an und zieht Energie ab. Deshalb werden Gesandte beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht in die Barbarei abgleiten.
Wenn ihr euch jetzt mal das Gegenteil dieser stringenten Zusammenfassung vorstellt, seid ihr recht nah dran am Schreibstil. Noch mehr störte mich allerdings die Beliebigkeit der Lösung von Problemen. Der Gesandte Johor etwa landet einmal am falschen Ort und bräuchte mehrere Wochen für die Reise. Aber hey, wir sind hier schließlich in einer selbst ausgedachten Welt, und da kann man doch einfach eine Disneyprinzessinnen-Szene draus machen: „Ich näherte mich einer Herde von Pferden, die an einem Berghang weideten, stellte mich vor sie hin und schaute sie konzentriert, in einer wortlosen Bitte um Hilfe an. Sie waren unruhig und verwirrt, aber dann kam eines der Tiere herüber, blieb wartend vor mir stehen, und ich saß auf. Ich lenkte es, und wir galoppierten nach Süden.“ Tja, okay, aber wie lange kann so ein Shikasta-Pferd wohl durchhalten? Auch dafür hat Lessing eine Lösung: „Da sah ich in der Nähe eine zweite Herde und ließ mich dorthin tragen. Ich stieg ab. Mein Reittier erklärte einem starken und kraftvollen Tier der zweiten Herde die Lage. Es kam heran und blieb stehen, ich stieg auf, und wir ritten los. Dies wiederholte sich mehrere Male.“
Wir fassen zusammen: Die Pferde auf dem erdähnlichen Planeten Shikasta, von denen zuvor übrigens überhaupt keine Rede war, können nur einen Tag laufen, aber die Gedanken von Menschen verstehen und anderen Pferden erklären. Weil es jetzt eben für die Geschichte gerade mal nötig ist.
Entschuldigt mich. Ich glaube, mir läuft gerade etwas flüssiges Hirn aus dem Ohr.
Was jetzt? Mit „Shikasta“ bin ich durch. Vielleicht versuche ich es mal mit etwas anderem von Doris Lessing. „Das goldene Notizbuch“ soll gut sein. Aber heute nicht mehr. Und morgen nicht gleich.
Doris Lessing: „Shikasta“. Roman. Aus dem Englischen von Helga Pfetsch. Goldmann Verlag, München 2001. 540 Seiten, Taschenbuch, 11 Euro.
#32 – Wolf Haas: „Brennerova“
Provenienz: Ich schenkte es meinem Bruder mit der Bitte, es mir zu leihen, wenn er damit durch ist. Es kam ganz zu mir zurück, weil er es nicht ertrug.
Ungelesen seit: zwei Wochen
 Dass überhaupt jemand etwas gegen Wolf Haas haben kann, hätte ich gar nicht gedacht. Witzig und schlau zugleich, wer schreibt schon so? Es stellte sich heraus, dass die Sprache nicht für jedermann etwas ist. Mein Bruder konnte sich an den österreichischen Duktus nicht gewöhnen, der unter anderem oftmals das Verb auslässt: „Die griesgrämige Lehrerin ist förmlich aus der Herta entwichen, Dämon nichts dagegen. Und an ihrer Stelle ist da eine gestanden, wo man sagen muss, Russinnen schön und gut, aber die einheimischen Weiber auch nicht zu verachten.“ Da ich den größten Teil meines Lebens in München verbracht habe und eine Leidenschaft für Österreich hege (Berge! Walzer! Mehlspeisen!), fällt mir so etwas nach ein paar Seiten kaum mehr auf. Es bleibt nur ein behagliches Gefühl.
Dass überhaupt jemand etwas gegen Wolf Haas haben kann, hätte ich gar nicht gedacht. Witzig und schlau zugleich, wer schreibt schon so? Es stellte sich heraus, dass die Sprache nicht für jedermann etwas ist. Mein Bruder konnte sich an den österreichischen Duktus nicht gewöhnen, der unter anderem oftmals das Verb auslässt: „Die griesgrämige Lehrerin ist förmlich aus der Herta entwichen, Dämon nichts dagegen. Und an ihrer Stelle ist da eine gestanden, wo man sagen muss, Russinnen schön und gut, aber die einheimischen Weiber auch nicht zu verachten.“ Da ich den größten Teil meines Lebens in München verbracht habe und eine Leidenschaft für Österreich hege (Berge! Walzer! Mehlspeisen!), fällt mir so etwas nach ein paar Seiten kaum mehr auf. Es bleibt nur ein behagliches Gefühl.
Dabei haben wir es hier natürlich mit einem Krimi zu tun. Allerdings atmen die Krimis von Wolf Haas um den mittlerweile ehemaligen Kommissar Brenner eine angenehme Bräsigkeit. Auch hier kommt selten diese Art Spannung auf, bei der man an seinen Fingerknöcheln nagen möchte. Schon der traditionelle Einstieg „Jetzt ist schon wieder was passiert“ klingt doch, als wuchte sich gerade jemand aus dem Lehnsessel hoch und ziehe erst einmal seine Cordhose zurecht, bevor er dann doch widerwillig die Leiche anschauen geht.
In „Brennerova“ gibt es aber erst mal gar keine Leiche. Sondern eine Russin namens Nadeshda, die dem Brenner anvertraut, dass ihre Schwester von Menschenhändlern verschleppt wurde. Sie bittet ihn um Hilfe, und weil ihre Augen gar so schön sind, macht sich der Brenner auf die Suche. Dabei landet er schnell in einem halbseidenen Milieu, was seine Freundin Herta überhaupt nicht gut findet. Zumal kurz nach Beginn seiner Recherchen zwei Männer mit abgehackten Händen im Krankenhaus landen.
Mit einem dieser Männer freundet der Brenner sich an und landet prompt selbst auf der Fahndungsliste der ehemaligen Kollegen. Und dann geht die Herta auch noch dauernd auf Wanderreisen und neigt dazu, sich dort in Einheimische heftig zu vergucken. Zum Glück ist der Brenner vom Leben schon so abgehärtet, dass ihm diese ganzen Niederungen kaum ein Zucken mit der Augenbraue abnötigen. Das finde ich persönlich großartig, denn ich hasse Bücher, bei dem Menschen immer tiefer in die Katastrophe rutschen und allmählich verzweifeln. Mir ist so ein abgestumpfter, frustrierter alter Typ, der nicht viel zu verlieren und deshalb vor nichts mehr Angst hat, tausendmal lieber. Na ja. Zumindest, wenn die Geschichte drumherum auch noch so komisch ist wie bei Wolf Haas. Ohne das geht’s nicht.
Was jetzt? Mein nächstes Versuchskaninchen für dieses Buch wird ein Herr aus dem hohen Norden. Mal schauen, wie er die fehlenden Verben und halben Sätze verkraftet.
Wolf Haas: „Brennerova“. Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2014. 239 Seiten, gebunden, 20 Euro.
#31 – Imre Kertész: „Detektivgeschichte“
Provenienz: adoptiert, weil vom Mann aussortiert
Ungelesen seit: etwa einem halben Jahr
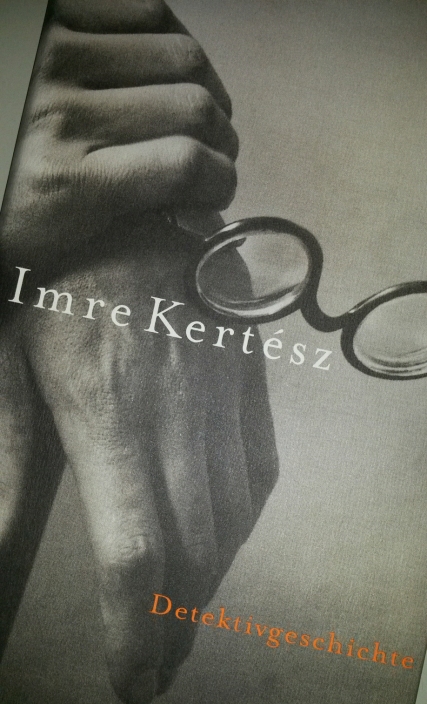 Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
Deshalb konnte ich es nicht mitansehen, wie die „Detektivgeschichte“ aus dem Regal flog. Erneut geht es um das Leben in einer Diktatur, aber diesmal befindet sich der Erzähler auf der Seite der Überwacher und Verfolger. Kertész wollte dieses Thema unbedingt aufgreifen, aber das war in Ungarn 1977 nicht ganz einfach. Es gab nur staatliche Buchverlage, und die Regierung hätte sich durchaus gemeint fühlen können. Deshalb verlegte Kertész die Handlung seines kurzen Romans in ein imaginäres Land in Südafrika. Das reichte offensichtlich aus, um die Zensoren zu befrieden.
Antonio Martens hat beim Geheimdienst angeheuert, weil ihm das von der Kripo aus als Karriereschritt erschien. Jetzt ist er in einem Team mit einem eiskalten Chef und einem bösartigen, sadistischen Kollegen. Bald haben die drei den Sohn eines schwerreichen Kaufhausbesitzers im Visier, der etwas gegen das Regime unternehmen will. Allerdings will keiner aus der Studentenbewegung etwas mit ihm zu tun haben. Sein Vater hingegen gibt sich ihm schließlich als Widerständler zu erkennen und setzt ihn als Kurier ein. Der Geheimdienst kommt dahinter und verhaftet und foltert beide. Soweit die Fakten.
Aber es ist nicht genau so, wie es aussieht. Der Vater hat sein ganz eigenes Ding gedreht, und Unschuldige müssen sterben, um die Behörde nicht in Misskredit zu bringen. Später wird Antonio Martens vor Gericht gestellt und erzählt vom Vorgehen des Geheimdienstes mit zusätzlichen Informationen aus dem Tagebuch des Sohnes, das er sich unter den Nagel gerissen hat. Er wirkt dabei abgestumpft, mit ganz wenigen Ausnahmen. Da ist sie wieder, diese neutrale Erzählweise von Kertész, die einen fertig machen kann. Fertig, wütend, entsetzt – und absolut fasziniert.
Was jetzt? Das behalte ich. Es wird nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein.
Imre Kertész: „Detektivgeschichte“. Roman. Aus dem Ungarischen von Angelika und Peter Máté. Rowohlt Verlag, Hamburg 2004. 138 Seiten, gebunden, 12.90 Euro.