Kategorie: Gesellschaftskritik
#35 – Doris Lessing: „Shikasta“
Provenienz: Jemand sortierte es aus, ich schaute empört, führte Doris Lessings Literaturnobelpreis ins Feld und adoptierte es. Fataler Fehler.
Ungelesen seit: etwa drei Jahren
 Dies ist das erste Buch des Blogprojekts, das ich abgebrochen habe. Weil ich mich kolossal langweilte und mir meine Lebenszeit zu schade war. Fun fact: „Shikasta“ ist nur der erste Band eines fünfteiligen Zyklus. Ein Umstand, den ein mir nahestehender Herr mit den Worten kommentierte: „Poah. Autoren sollten einfach nicht so alt werden.“
Dies ist das erste Buch des Blogprojekts, das ich abgebrochen habe. Weil ich mich kolossal langweilte und mir meine Lebenszeit zu schade war. Fun fact: „Shikasta“ ist nur der erste Band eines fünfteiligen Zyklus. Ein Umstand, den ein mir nahestehender Herr mit den Worten kommentierte: „Poah. Autoren sollten einfach nicht so alt werden.“
Zu diesem Zyklus wurde Lessing nach eigenen Angaben von der islamischen Mystik und der Weltsicht des Sufismus inspiriert, aber das muss man schon wissen, um es zu bemerken. Schließlich gibt es asketisch-spirituelle Anklänge auch in zahlreichen anderen Werken. Leider werde ich nicht mehr erfahren, ob es bei Lessing später deutlicher zutage tritt. Vielleicht geht es ja in den anderen Bänden total rund. Und vielleicht sogar in den dreihundert Seiten dieses Buches, deren Lektüre ich beim besten Willen nicht mehr auf mich nehmen werde. Bisher allerdings ist das alles äußerst verquast. Übrigens habe ich euch den vollständigen Titel bisher vorenthalten, das holen wir gleich mal nach:
Canopus im Argos: Archive
Btr.: Kolonisierter Planet 5
Shikasta
Persönliche, psychologische und historische Dokumente zum Buch von JOHOR (George Sherban)
Abgesandter (Grad 9)
87. Periode der letzten Tage
Man ahnt schon: Science Fiction. Space Fiction gar, wie Lessing das nennt, die sich schon im Vorwort mit der Erzählung einer Anekdote bei mir unbeliebt gemacht hat. Sie beschreibt, wie sie zum Vortrag bei einer Universität geladen war und dort sagte, Space Fiction und Science Fiction bildeten „den originellsten Zweig der heutigen Literatur“, seien „einfallsreich und witzig“ und hätten auf alle möglichen anderen Werke „belebend gewirkt“. Die literarische Welt sei zu tadeln, weil sie das nicht hoch genug schätze. Dass eine Professorin zu widersprechen wagte, quittiert Lessing mit den Worten, jene habe sich „wohl zu lange von Akademiens keuschen Früchten genährt“. Das war mir als Eigenwerbung einfach zu plump. Schade, wenn der Leser die Autorin für arrogant und selbstgerecht hält, ehe er zum eigentlichen Roman kommt.
Tatsächlich bin ich kein großer Science-Fiction-Fan, und damit mir ein Werk aus diesem Genre gefällt, muss es genau das sein, was Lessing beschreibt: witzig oder einfallsreich, und mit einfallsreich meine ich, dass die Welt, die darin erschaffen wurde, eine innere Logik besitzt. Leider habe ich genau das bei Lessing schmerzlich vermisst. Es geht um den Planeten Shikasta, der unter dem Protektorat des Verbundes Canopus steht (und der Erde übrigens frappierend ähnelt). Canopus möchte die Entwicklung der menschenähnlichen Lebewesen beschleunigen und siedelt deshalb Riesen an, die die Menschen unterstützen. Doch dann kommt der Planet wegen kosmischer Umwälzungen aus dem Gleichgewicht. Außerdem greift ein Schurkenplanet an und zieht Energie ab. Deshalb werden Gesandte beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht in die Barbarei abgleiten.
Wenn ihr euch jetzt mal das Gegenteil dieser stringenten Zusammenfassung vorstellt, seid ihr recht nah dran am Schreibstil. Noch mehr störte mich allerdings die Beliebigkeit der Lösung von Problemen. Der Gesandte Johor etwa landet einmal am falschen Ort und bräuchte mehrere Wochen für die Reise. Aber hey, wir sind hier schließlich in einer selbst ausgedachten Welt, und da kann man doch einfach eine Disneyprinzessinnen-Szene draus machen: „Ich näherte mich einer Herde von Pferden, die an einem Berghang weideten, stellte mich vor sie hin und schaute sie konzentriert, in einer wortlosen Bitte um Hilfe an. Sie waren unruhig und verwirrt, aber dann kam eines der Tiere herüber, blieb wartend vor mir stehen, und ich saß auf. Ich lenkte es, und wir galoppierten nach Süden.“ Tja, okay, aber wie lange kann so ein Shikasta-Pferd wohl durchhalten? Auch dafür hat Lessing eine Lösung: „Da sah ich in der Nähe eine zweite Herde und ließ mich dorthin tragen. Ich stieg ab. Mein Reittier erklärte einem starken und kraftvollen Tier der zweiten Herde die Lage. Es kam heran und blieb stehen, ich stieg auf, und wir ritten los. Dies wiederholte sich mehrere Male.“
Wir fassen zusammen: Die Pferde auf dem erdähnlichen Planeten Shikasta, von denen zuvor übrigens überhaupt keine Rede war, können nur einen Tag laufen, aber die Gedanken von Menschen verstehen und anderen Pferden erklären. Weil es jetzt eben für die Geschichte gerade mal nötig ist.
Entschuldigt mich. Ich glaube, mir läuft gerade etwas flüssiges Hirn aus dem Ohr.
Was jetzt? Mit „Shikasta“ bin ich durch. Vielleicht versuche ich es mal mit etwas anderem von Doris Lessing. „Das goldene Notizbuch“ soll gut sein. Aber heute nicht mehr. Und morgen nicht gleich.
Doris Lessing: „Shikasta“. Roman. Aus dem Englischen von Helga Pfetsch. Goldmann Verlag, München 2001. 540 Seiten, Taschenbuch, 11 Euro.
#30 – W. Somerset Maugham: „Winter-Kreuzfahrt“
Provenienz: nicht mehr nachvollziehbar
Ungelesen seit: sechs oder sieben Jahren, schätze ich
 Dieses Buch wollte ich mir eigentlich schon das ganze Jahr vornehmen. Dachte aber, Winter-Kreuzfahrt, das hebst du dir für den Winter auf, da passt das besser. Das ist gleich auf mehreren Ebenen völliger Unsinn, schließlich kann man auch im Sommer im Winter spielende Bücher lesen. Aber vor allem stellte sich heraus, dass viele Kurzgeschichten in der Gegend um Thailand, Birma, Singapur und Indien spielen. Der Winter im Buch ist also nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt hatte.
Dieses Buch wollte ich mir eigentlich schon das ganze Jahr vornehmen. Dachte aber, Winter-Kreuzfahrt, das hebst du dir für den Winter auf, da passt das besser. Das ist gleich auf mehreren Ebenen völliger Unsinn, schließlich kann man auch im Sommer im Winter spielende Bücher lesen. Aber vor allem stellte sich heraus, dass viele Kurzgeschichten in der Gegend um Thailand, Birma, Singapur und Indien spielen. Der Winter im Buch ist also nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt hatte.
Von W. Somerset Maugham hatte ich noch nie etwas gelesen. Er selbst fand sich so mittelbegabt, Kritiker lobten vor allem seine Kurzgeschichten. Offenbar habe ich da also gleich die richtige Lektüre erwischt. Die meisten Figuren stammen aus demselben Milieu, sind also mehr oder minder wohlhabende Briten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Italien oder in die Kolonialgebiete reisen. Da sind ein paar ulkige Gestalten dabei, und Maugham zeichnet sie so messerscharf, dass man sie zu kennen glaubt. Manchmal wohlwollend, aber manchmal auch beißend satirisch.
Es gibt beeindruckende Einblicke in das Leben auf einer Gefängnisinsel, die unglückliche Vergangenheit einer Frau, die dem Erzähler zufällig nach Jahren wieder begegnet, und das Schicksal eines Aussteigers, dem das Geld ausgeht. Am besten gefiel mir die Titelgeschichte. Darin begibt sich Miss Reid, die einen Teeladen betreibt, für die Ferien auf einen Dampfer. Von Plymouth geht es bis zu den Westindischen Inseln und wieder retour. Miss Reid stört sich nicht am mangelnden Luxus, mag Bücher und unterhält sich gern: „Sie verstand die Leute auszufragen, und jedes Mal, wenn ein Thema erschöpft schien, hatte sie eine Bemerkung bereit, um es wieder zu beleben, oder ein neues Thema lag ihr schon auf der Zungenspitze, um die Konversation wieder in Gang zu bringen.“
Solcherlei erzählt Maugham ganz charmant über Miss Reid, und erst nach einigen Seiten kam mir der Gedanke: Moment mal, sie klingt echt nervtötend. Prompt dreht die Geschichte und wird so weitererzählt, wie der Kapitän und die Mannschaft ihre Passagierin sehen. Sie treibt alle in den Wahnsinn mit ihrem Geschwätz, und auch wenn die Höflichkeit gebietet, dass sie am Kapitänstisch sitzt, muss der Kapitän seinem Ärger hierüber hin und wieder Luft machen. Dazu singt er Wagner-Arien mit eigenem Text: „Oh, welche Pest ist dieses Weib, ich bringe es um, wenn das so bleibt!“ – auf die Melodie des Liedes vom Abendstern aus Tannhäuser.
Schließlich naht Weihnachten, und die Mannschaft befürchtet, Miss Reid werde allen das Fest verderben. Der Doktor empfiehlt, sie brauche nur einmal einen Liebhaber. Alle drücken sich, bis schließlich die Wahl auf den Funker fällt. Der stellt sich allerdings recht dämlich an.
Wenn wir mal von der wenig erfreulichen, aber damals wohl nicht unüblichen Haltung „Die Frau ist hysterisch und muss nur mal wieder gebumst werden“ absehen, ist diese Geschichte wirklich ein großes Vergnügen. Aber auch alle anderen lohnen die (ohnehin kurze) Aufmerksamkeitsspanne, die man ihnen widmet. Diese ganze koloniale Welt des edlen Reisens hat wirklich Stil, und ähnlich wie in Judith Hermanns „Sommerhaus, später“ mochte ich, dass sich eigentlich alle, obwohl theoretisch durchaus berufstätig, dem süßen Nichtstun hingeben. Es entspannt mich offenbar, anderen beim Entspannen zuzusehen. Man wird ja bescheiden.
Was jetzt? Ich würde es gern behalten, rechne aber damit, dass sich ein Familienmitglied als Besitzer meldet.
W. Somerset Maugham: „Winter-Kreuzfahrt“. Erzählungen. Diogenes Verlag, Zürich 1972. 167 Seiten, Taschenbuch, 14.90 DM (damals, hach.)
#9 – Katherine Mansfield: „Glück“
Provenienz: Der Widmung ist zu entnehmen, dass meine Mutter dieses Buch zum 27. Geburtstag von ihren Eltern geschenkt bekam. Irgendwann danach wanderte es in mein Bücherregal. Wahrscheinlich mit einer Leseempfehlung, der ich nun endlich nachkomme.
Ungelesen seit: Puh, es ist schon zu lange bei mir, um das feststellen zu können. Sagen wir mal – acht Jahre?
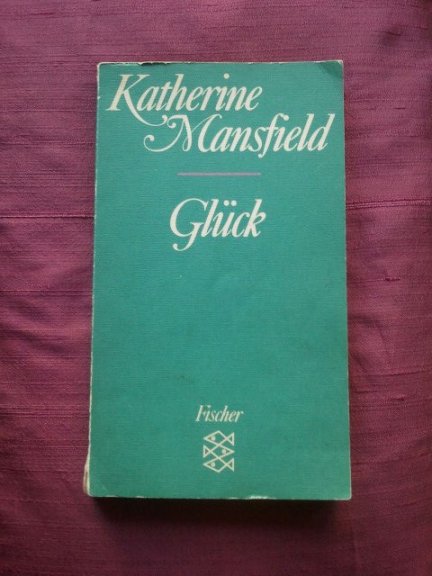 Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.
Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.
Darin geht es um eine junge Frau namens Bertha, die mit ihrem Baby und ihrem Mann und dem Haus auf dem Land einfach vollkommen glücklich ist. Zu einer Abendgesellschaft lädt sie ihren girl crush ein, Miss Fulton, die von Berthas Mann gründlich verachtet wird. An diesem Abend passiert etwas Eigenartiges: Berthas Libido erwacht – erstmals. Bisher hat sie sich für frigide gehalten. Während man sich noch fragt, ob diese plötzliche Lust auf ihren Ehemann von ihrer Schwärmerei für Miss Fulton herrührt, stellt Bertha fest, dass die beiden ein Geheimnis teilen. Und schon zerbricht das ganze schöne Glück.
Mansfield hat einen interessanten Blick auf ihre Figuren. Einerseits ist das bitterböse Gesellschaftssatire, die an Dorothy Parker erinnert. Andererseits gibt es immer wieder Figuren, die sie ganz ernst meint und nimmt. Vor allem Kinder, wie in der Geschichte „Sonne und Mond“: Zwei Geschwister erfreuen sich an den spannenden Vorbereitungen für eine große Party der Eltern und kommen mitten in der Nacht hinunter, als alles vorbei ist. Die prächtig geschmückte Tafel ist jetzt aber ein einziges Chaos. Die Eisbombe, ein Bild des Jammers. Sofort fängt eins der Kinder an, völlig entsetzt loszubrüllen.
Mehr als solche kleinen Szenen sind es oft gar nicht, die Mansfield beschreibt. Aber sie macht das mit einer so zarten Sprache und feinen Betrachtungsweise. Stellt euch ein Aquarell vor, das ein schlichtes Stillleben zeigt – und zwar meisterhaft gemalt. Darin liegt die Anziehungskraft von Mansfields Geschichten.
Was jetzt? Meine Mutter bekommt es zurück. Bestimmt hat sie es schon vermisst.
Katherine Mansfield: „Glück“. Erzählungen. Fischer Verlag, Frankfurt 1982. Taschenbuch, 217 Seiten, vergriffen.
#6 – Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“
Provenienz: Dieses Buch habe ich mir vor einem Toskana-Urlaub mit Freundinnen gekauft. Hatte herrliche Visionen davon, wie ich es am Pool liegend lesen würde. Es stellte sich aber heraus, dass meine Freundinnen noch bessere Unterhaltung bieten.
Ungelesen seit: knapp zwei Jahren
Der vollständige Name des Autors lautet Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, und alleine das nimmt mich schon für ihn ein. Seine Familie war frisch in den Adelsstand erhoben, als er geboren wurde. Der Mann war ein klassisches One-Hit-Wonder: 1782 schrieb er seinen einzigen großen Erfolg „Gefährliche Liebschaften“, im Original „Les Liaisons dangereuses“. Der französische Titel ist insofern treffender, als nicht nur Liebschaften gefährlich sind, sondern auch die Allianzen, die die Figuren eingehen.
Aber der Reihe nach: Die Welt dieses Romans teilt sich anfangs relativ klar ein in Gut (interessanterweise dem neuen Adel zugehörig, wie der Autor) und Böse (alter Adel). Das ist ja immer erfreulich, weil leicht zu erklären. Auf der einen Seite stehen die tugendhafte Madame de Tourvel, deren Gatte für längere Zeit im Ausland weilt, und die junge Cécile de Volanges, deren Mutter sie gerade aus der Klosterschule geholt hat, um sie mit dem Grafen Gercourt zu verheiraten. Zwei wirklich brave Mädchen. Dann gibt es noch Danceny, der Cécile Musikunterricht gibt. Die beiden verlieben sich ineinander, aber ihre Beziehung bleibt trotz aller Liebesschwüre unschuldig.
In der Ecke der Herausforderer: der Vicomte de Valmont, ein bekannter Frauenverführer und Tunichtgut, der sich zum Ziel gesetzt hat, Madame de Tourvel zu verführen. An seiner Seite kämpft die Marquise de Merteuil, die für Cécile de Volanges eine mütterliche Freundin ist und alles daran setzt, das junge Mädchen noch vor der Hochzeit moralisch zu Fall zu bringen. Denn der Graf Gercourt hat die Marquise einmal verlassen und ist seitdem ihr Erzfeind. Deshalb trachtet sie danach, seine jugendliche Braut zu verderben.
„Gefährliche Liebschaften“ ist ein Briefroman, und wenn man anderen Büchern vorwirft, sie seien konstruiert, so muss das hier als Kompliment gelten. Laclos hat zwei Ebenen geschaffen, die einander unterstützen: In den Briefen der Bösen an die Guten ist alles eine einzige Heuchelei; in den Briefen der Bösewichter untereinander legen sie ihre Machenschaften und niederen Beweggründe offen. Diese Briefe bieten immer wieder Überraschungen – und auch die Durchtriebenheit und fiesen Kniffe nötigten mir Respekt ab.
Dafür habe ich am Anfang immer mal wieder quer gelesen, denn die Liebenden machen mit schöner Ausdauer immer einen Schritt vor und einen zurück. Die Briefe sind voller Beteuerungen, Vorwürfe und unnötiger Dramatisierungen. Vielleicht muss man das Buch mit Anfang zwanzig lesen, in einer romantischen Phase, um dieses ganze Geblubber nicht über zu bekommen: „Ich werde mir immer einreden, Ihr Herz sei fühllos. Ich werde mir sogar Mühe geben, Sie nicht mehr so oft zu sehen, und halte jetzt schon Ausschau nach einem triftigen Vorwand. Wie? Ich soll die liebe Gewohnheit aufgeben, Sie tagtäglich zu sehen? Ach, wenigstens werde ich nie aufhören, mich danach zu sehnen! Ein Unglück ohne Ende wird der Lohn für die zärtlichste Liebe sein.“
Ächz. Nur die Briefe von Valmont und der Marquise, die sich über die romantischen Dummheiten der anderen mokieren, haben mich das ertragen lassen.
Das größte Vergnügen allerdings bieten die ausgefeilten Psychogramme, die das Buch zeichnet. Die Masken, mit denen alle hantieren, werden nach und nach abgerissen – und nicht immer ist das, was zum Vorschein kommt, schlecht. Trotzdem sind am Ende natürlich alle dem Elend geweiht. Es mag mich nicht in ein weiches Licht setzen, aber mich hat das zufrieden gemacht: Die Romantiker haben mich zuvor doch einigermaßen genervt, und die Intriganten haben es auch nicht besser verdient.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Ich suche noch einen netten Nachbarn für das Buch – vielleicht Jane Austen.
Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“. Roman. Aus dem Französischen von Walter Widmer. Harenberg, Dortmund 1986. 346 Seiten, gebunden, in dieser Ausgabe vergriffen.
#2 – Franziska Gräfin zu Reventlow: „Herrn Dames Aufzeichnungen“
Provenienz: Ich ging in Begleitung in einen Laden, sah das Buch, sagte: „Oh, das hätte ich gern.“ Ging dann unauffällig weg und bekam es zu Weihnachten geschenkt. Subtilität hab ich voll drauf.
Ungelesen seit: zwei Jahren
 Es gibt ja diese amerikanischen Highschool-Filme, in denen ein neuer Mitschüler aus der Provinz zwar nicht unfreundlich aufgenommen wird, aber doch erst mal die ganzen Modewörter lernen muss. Heimlich hofft er, bei den coolen Cliquen aufgenommen zu werden. Aber daraus wird nichts, und bei den Mädels, auf die er steht, hat er nicht den Hauch einer Chance.
Es gibt ja diese amerikanischen Highschool-Filme, in denen ein neuer Mitschüler aus der Provinz zwar nicht unfreundlich aufgenommen wird, aber doch erst mal die ganzen Modewörter lernen muss. Heimlich hofft er, bei den coolen Cliquen aufgenommen zu werden. Aber daraus wird nichts, und bei den Mädels, auf die er steht, hat er nicht den Hauch einer Chance.
Ist es nun beruhigend oder besorgniserregend, dass „Herrn Dames Aufzeichnungen“ diese Situation bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts schildern? Und zwar nicht bei Teenagern, sondern bei Erwachsenen – sofern in der wilden Schwabinger Bohème überhaupt jemand Gelegenheit hatte, richtig erwachsen zu werden. Der junge Herr Dame weiß nicht recht, was er studieren soll, wird erst mal von seinem Stiefvater nach München geschickt, um sich zu amüsieren, und landet mitten in der vergnügungssüchtigen Gesellschaft von, wie die Autorin das im Buch nennt, Wahnmoching.
(Wahnmoching nenne ich übrigens ab sofort das Gefühl, wenn man es für schlau hielt, vom Münchner Flughafen kommend in Feldmoching umzusteigen, und dann dort neunzehneinhalb Minuten warten muss.)
Franziska Gräfin zu Reventlow hat eine lesenswerte Biographie und war selbst Teil jener Schwabinger Bohème, in die sie den Neuling schickt. 1913 veröffentlichte sie das Buch – da hatten sich die schrägen spirituellen Zirkel schon weitgehend aufgelöst. Alle Figuren sind an Freunde von ihr angelehnt, und auch sie selbst spielt eine nicht unwichtige Rolle. Trotzdem verlegt sie sich vollständig auf die Satire. Einer der Zirkel schwärmt für das Heidentum, einer nennt immer alles „kosmisch“, einer der Wortführer empfindet sich selbst als alter Römer, und enge Kontakte mit weniger Erleuchteten sind ausgesprochen unerwünscht. All das wird mit großer Ernsthaftigkeit betrieben und erinnert an eine Esoterikmesse. Immerhin gibt es noch das lebensfrohe Eckhaus, in dem Herr Dame schnell Freunde findet, mit denen er sich ins wilde Leben stürzt. Sympathische Exzentriker, eine Zierde für jedes Buch.
Die ulkigste Rolle ist der dem Dichter Stefan George nachempfundene „Meister“. Er wird geradezu kultisch verehrt und hält sich bei Empfängen stets nur im dritten Salon auf, wohin nur Eingeweihte vorgelassen werden. Einzig an Fasching mischt er sich unters Volk – wo aber bereits Vertraute von ihm sitzen und verbreiten, das sei er natürlich nicht selbst. Das sei nur irgendwer mit einer dem Meister täuschend ähnelnden Maske.
Wie der schüchterne Herr Dame da hineingeworfen wird und eifrig alles notiert, um mitzukommen – das ist wirklich entzückend und immer wieder sehr amüsant. Dazu gibt es noch eine überflüssige Rahmenhandlung, nach der Herr Dame auf einer Schiffsreise seine Aufzeichnungen einer Bekanntschaft übergibt und danach verunglückt. Diese Bekanntschaft gibt das Manuskript an einen Lektor weiter, und wir haben ihr immerhin die folgende Anmerkung zu verdanken, die so viel über das journalistische „wir“ in Reportagen verrät:
„Wie armselig, wie vereinzelt, wie prätentiös und peinlich unterstrichen steht das erzählende oder erlebende ‚Ich‘ da – wie reich und stark dagegen das ‚Wir‘. Wir können in dem, was um uns ist, irgendwie aufgehen, untergehen – harmonisch damit verschmelzen. – Ich springt immer wieder heraus, schnell wieder empor, wie die kleinen Teufel in Holzschachteln, die man auf dem Jahrmarkt kauft. Immer strebt es nach Zusammenhängen – und findet sie nicht. – Wir brauchen keinen Zusammenhang, – wir sind selbst einer.“
Was jetzt? Darf bleiben. Das stelle ich neben die „Geschichten aus dem alten München“, die ich auch mal lesen sollte.
Franziska Gräfin zu Reventlow: „Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil“. Süddeutsche Zeitung Bibliothek, München 2008. 121 Seiten, gebunden, 8.50 Euro.
(Diese Ausgabe scheint vergriffen zu sein. Es gibt das Buch aber auch beim Projekt Gutenberg.)
