Kategorie: Liebe
#45 – Nora Roberts: „Töchter des Windes“
Provenienz: vom Verlag zugeschickt bekommen
Ungelesen seit: fünf Monaten
Zufällig veröffentliche ich beim selben Verlag wie Nora Roberts, wo man um meine kleine Schwäche für sie weiß und mir deshalb ein Paket mit einer kleinen Auswahl ihres gewaltigen Œuvres gepackt hat. Falls ihr euch schon ewig fragt, wer den Scheiß eigentlich liest: ich. Ich les den Scheiß. Dafür brauche ich aber immer gute Gründe. Eine schwere Erkältung etwa bringt mich auf genau das richtige intellektuelle Level. Diesmal war es die Einrichtung und Renovierung meiner neuen Wohnung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Derzeit komme ich abends von der Redaktion nach Hause, zieh das Röckchen aus, die Handwerkerhose an und die Werkzeugkiste hinter mir her.
 Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Die Geschichte, tja. Kennste eine, kennste alle: Brianna führt eine Pension in Irland und ist eine rechtschaffene Unschuld vom Lande, wobei Unschuld auch noch ganz wörtlich zu verstehen ist. Dann mietet sich Grayson für einige Monate bei ihr ein, ein Amerikaner, der in der Abgeschiedenheit einen seiner blutrünstigen Thriller schreiben will. Er hat natürlich eine düstere Vergangenheit, Heimkind, Straßenjunge, Kleinkrimineller, ist jetzt aber vollkommen geläutert und noch dazu scheißreich, was der braven Brianna selbstverständlich überhaupt nichts bedeutet. Man kommt sich näher, sie heilt seine kaputte Seele mit der Kraft ihrer Liebe. Bin ich die einzige, die sich an „Fifty Shades of Grey“ erinnert fühlt? Es hat was davon, war aber erstens lange vorher da und ergeht sich zweitens eher in Kerzenschein-und-Flanellnachthemd-Erotik. Keine Peitschen, nirgends.
Was genau daran mich dazu treibt, bis zum Ende zu lesen? Ehrlich, ich hab keine Ahnung. Man weiß von Anfang an, wie es ausgeht, selbst die zweite große Krise ist völlig vorhersehbar. Das ist bei Genre-Romanen ja oft so, aber bei Nora Roberts hat man schon gelegentlich den Eindruck, sie tauscht von Buch zu Buch nur die Namen, den Schauplatz und die Berufe ihrer Figuren aus. Übrigens ist dies Teil zwei einer Trilogie, also nehme ich das mit dem Schauplatz zurück, denn es spielt alles in diesem Umfeld. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Wenn man sein Gehirn mal so richtig ausknipsen will, ist das perfekt. Als Kind hab ich immer wieder dieselbe Kasperleplatte gehört, wenn ich krank war, heute sind es eben leicht variierte Kitschromane. (Ja, da steht Platte. SCHALLPLATTE. So alt bin ich.)
Was jetzt? Ich verstecke es irgendwo im Bücherregal und deklariere es als Recherche.
Nora Roberts: „Töchter des Windes“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Uta Hege. Blanvalet Verlag, München 2014 (drölfzigste Auflage). 477 Seiten, Taschenbuch, 9.99 Euro.
#42 – Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“
Provenienz: Geschenk zum Dreißigsten (schon wieder! Und immer noch!)
Ungelesen seit: Ja, ja, drei Jahren. Hmpf.
 Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Immer diese Schwedinnen. Können wir vielleicht mal ein modernes Buch über eine verklemmte Schwedin lesen? Ich meine, wie stehen die deutschen Frauen in der Weltliteratur denn bitte da, wenn diese Nordlichter immer so wunderschön und sexuell selbstbewusst sind? Katarina jedenfalls ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Architektin und will sich nicht auf eine feste Beziehung einlassen, weshalb sie eine kurze Affäre an die andere reiht: „In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.“
Jetzt aber ist Katarina schwanger von ihrer Sommerliebe Jack, einem Amerikaner, der zu Hause Frau und Kinder hat. Und sie ist auf dem Weg zu ihrer Mutter, um ihr davon zu erzählen: dass sie das Kind will, aber den Mann nicht, obwohl er ihr mehr bedeutet als alle anderen davor. Das Verhältnis zur Mutter ist herzlich, aber nicht unbelastet – als Katarina klein war, wischte sie ihrer Mutter das Blut aus dem Gesicht, wenn der Vater sie wieder krankenhausreif geschlagen hatte. Auch Jack hat eine ähnliche Familiengeschichte. Als Katarina von ihrem Kurzurlaub bei der Mutter zurückkehrt, erwartet er sie – und prügelt auf sie ein, als er von der Schwangerschaft erfährt.
Gibt es familiäre Muster, aus denen wir nicht ausbrechen können? Zieht Gewalt automatisch Gewalt nach sich? Das sind die großen Fragen, die „Geliebte Tochter“ aufwirft. Katarina wird nach Jacks Schlägen von ihrem Bruder Olof und dessen Frau Erika gesund gepflegt und beginnt, gemeinsam mit ihrer Mutter ihre traumatischen Kindheitserinnerungen aufzuarbeiten. Die Nähe zur Familie tut ihr gut, aber gleichzeitig ist sie eifersüchtig auf die besondere Beziehung ihrer Schwägerin zu ihrer Mutter und empfindet sich als Last, was sie durch finanzielles Engagement auszugleichen sucht.
Marianne Fredriksson widmet sich Katarina, aber sie verliert auch Jack nicht aus den Augen. Er geht zurück nach Amerika, geplagt von Schuldgefühlen, und stürzt dort vollkommen ab, ehe ausgerechnet sein Vater, der früher selbst zugeschlagen hat, ihn auffängt.
Diese ganzen menschlichen Dramen, die sich da aneinander reihen, sind ganz klug und schlicht erzählt. Überhaupt ist der Tonfall sehr geradeheraus, stellenweise in der Übersetzung für meinen Geschmack sogar etwas zu lakonisch geraten. Ein paar inhaltliche Dinge sind ebenfalls irritierend: Olof und Erika haben zwei Jungs aus Vietnam adoptiert, und Jack findet es völlig abgefahren, dass sie „chinesische Kinder“ haben. Der Typ ist New Yorker, sollte ihn ethnische Vielfalt wirklich so aus der Bahn werfen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ach ja, und dann verliebt Katarina sich wieder, diesmal ernsthaft, aber der Mann ist offensichtlich ein Filou. Und was sagt unsere starke, schöne Schwedin da zu ihrer Mutter über ihn? „[Er] ist ein richtiges Hänschen klein, das in die weite Welt hineingeht und sich gern auf sein Mütterlein besinnt.“ Mit dem Mütterlein meint sie sich als seine Lebenspartnerin. Boah. Im Ernst jetzt, Mädels? Ich dachte, wir wären darüber hinweg, Männer als schwachsinnige Kinder darzustellen.
Was jetzt? Das Buch darf bleiben. Wer weiß, vielleicht muss ich mich dem Männerbild ja eines Tages anschließen.
Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter“. Roman. Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2010. 368 Seiten, gebunden, 8.90 Euro.
#41 – Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“
Provenienz: selbst gekauft, weil: Wolf Haas!
Ungelesen seit: ein oder zwei Jahren
 Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Auch hier möchte ich nicht zu viel der phantastischen kleinen Ideen verraten, die in diesem Buch stecken. Nur die erste, die wie eine Einführung wirkt: Benjamin Lee Baumberger, der Protagonist und beste Freund des Erzählers, irrt durch einen Markt in England, wo er sich gerade unglaublich in eine Burgerverkäuferin verliebt hat. Er sucht sie, um sie abzuholen und den Abend mit ihr zu verbringen, doch er geht zuerst geradeaus und biegt dann links ab – und der Text, eine einzelne Zeile auf der Seite, macht dasselbe.
Das ist natürlich ganz schön verspielt und schreckt wahrscheinlich den Klassiker-Leser eher ab. Ich fand es großartig. Diese Seiten machen mehr aus der Geschichte, es ist wie ein kleines Sketchbook. Apropos Geschichte, da war doch was. Also: Wenn Benjamin Lee Baumberger sich verliebt, bricht fast immer in seiner Nähe eine Seuche aus. BSE, Vogelgrippe, Schweinepest: Er ist immer mittendrin statt nur dabei. Hier schlägt sich die Liebe der Österreicher zum ständigen Thematisieren von Krankheiten, diese seltsame Volkshypochondrie, literarisch aufs Schönste nieder. (Ja, das ist ein Pauschalurteil. Liebe Österreicher ohne hypochondrische Anwandlungen: Meldet euch gerne bei mir und beweist mir, dass ich falsch liege.)
Zum Glück verliebt Benjamin Lee sich zwischenzeitlich sehr lange nicht: Er ist in festen Händen. Das ist die Phase, in der der Erzähler sich mit ihm anfreundet und sich auch gleich noch in seine Frau verguckt. Als Benjamin Lee sich in Peking die Vogelgrippe einfängt und mit einer Holländerin vorübergehend verschwindet, versucht der Erzähler die besorgte Ehefrau zu trösten, löst aber unabsichtlich die finale Ehekrise aus.
Ganz, ganz wunderbar fand ich auch, dass Haas statt atmosphärischen Beschreibungen oft einfach nur [LONDON, FRISUREN, MODE] oder [BESCHREIBUNG DER BRÜCKE] einfügt. Diese Stellen kenne ich als Autorin nur zu gut, aber die Chuzpe, daraus einen Running Gag zu machen, muss man erst mal haben. Meine Lieblingsstelle ist [PARKATMOSPHÄRE EINFÜGEN. BÄUME UND LEUTE ETC. EVTL. VON BRUNO SCHREIBEN LASSEN. ODER VON HELGA, FALLS SIE SCHON WIEDER DA IST].
Das hat mich ein bisschen an diesen Tweet erinnert:
Was jetzt? Als nächstes muss es der Mann lesen, und dann werde ich es etwa drölfzigtausend Mal nachkaufen und verschenken.
Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“. Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 239 Seiten, gebunden, 19.90 Euro.
#40 – Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“
Provenienz: Geschenkt bekommen.
Ungelesen seit: drei Jahren
 Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Jedenfalls wirkt „Die Frau des Zeitreisenden“ von außen fröhlich, geradezu trivial. Das hat der Roman mal wieder dem Klappentext zu verdanken: „Clare fällt aus allen Himmeln, jedes Mal aufs Neue, wenn Henry vor ihr steht. […] Seine Zeitreisen sind das brennende Geheimnis, das Henry und Clare mit jeder Trennung noch inniger vereint.“ Brennendes Geheimnis? Geht’s noch? Groschenroman, ick hör dir trapsen. Solche Sätze hat das Buch nicht verdient!
Tatsächlich handelt es sich um eine romantische Liebesgeschichte, die erstaunlich wenig creepy ist, obwohl sie alle Zutaten hätte. Schließlich besucht der Zeitreisende Henry seine Frau Clare, als jene noch ein Kind und später ein junges Mädchen ist, das ihn unbedingt verführen möchte. Das klappt erst spät, dann allerdings haben die beiden dauernd Sex, unentwegt, es ist fast etwas redundant, aber gut, wir halten fest: Sie begehren einander sehr.
Und dann wird es heikel. Ich kann leider nicht allzu viel verraten, jedenfalls wird diese fröhliche, beseelte und leicht paranormale Liebesgeschichte ganz langsam ausgebremst. Es deutet sich an, aber weil ich das überhaupt nicht glauben mochte, habe ich natürlich doch bis zum Schluss gelesen. Hätte ich das doch mal besser gelassen.
Romantiker! Lest das Buch, klappt es in der Mitte zu, denkt euch irgendwas von „Happily ever after“ und geht einen Tee trinken. Lest nicht weiter. Ehrlich jetzt, hört auf meinen Rat, ich meine es nur gut.
Und für jene von euch, die eine Axt suchen für das gefrorene Meer in sich: Dieses Buch ist aber so was von eine Axt. Tretet beiseite, wenn die Späne fliegen.
Was jetzt? Ich behalte es, aber das kommt in die „Handle with care“-Ecke.
Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2004. 825 Seiten, geb., 10 Euro.
#38 – Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder“
Provenienz: Ich wollte ein Buch von Kaléko verschenken. Ganz aus Versehen kaufte ich dann gleich noch ein zweites. Für mich.
Ungelesen seit: etwa einem Jahr
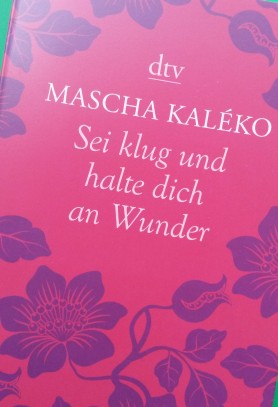 Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
So sehr ich Lyrik liebe, so wenig kann ich meist mit zeitgenössischer Dichtung anfangen. Was ich mag, endet mit wenigen Ausnahmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das war eine goldene Zeit, selbst wenn man nur die populärsten Dichter Kästner, Ringelnatz und Tucholsky berücksichtigt. Mit letzterem übrigens hat Mascha Kaléko die größte Ähnlichkeit. Wie Tucholsky ist sie zugleich lebensklug, gefühlvoll und auf eine lakonische Art sehr, sehr witzig. „Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an!“, schrieb Tucholsky selbst über sie.
Und das war sie, fürwahr. Kommen wir zu den Belegen! In „Ausverkauf in gutem Rat“ etwa schreibt sie:
Denn: So einer in Not ist,
bekommt er immerfort
guten Rat. Seltener, Whisky.
Ganz wunderbar fand ich auch diesen Vierzeiler:
Halte dein Herz an der Leine
Das ist vernünftig, mein Sohn!
(Aber, ganz ehrlich: das meine
Lief mir noch immer davon.)
Wenn endlich mal jemand die Seufzertaste für die Tastatur erfinden würde, könnte ich meine Gefühle in solchen Fällen angemessen zum Ausdruck bringen. So bleibt mir nur, zu schreiben: Lest Mascha Kaléko! Ihr alle! Ihr werdet es nicht bereuen. Ehrlich.
Was jetzt? Regalbrett „Lieblingsdichter“.
Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder. Gedanken über das Leben“. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2013. 170 Seiten, Taschenbuch, 7.90 Euro.
#29 – Tobie Nathan: „Verliebt machen. Warum Liebe kein Zufall ist“
Provenienz: für die Recherche zu einem Artikel bestellt
Ungelesen seit: zwei Tagen
 Wir haben es hier mit einem schönen Beispiel von strikt auf den Markt ausgerichteter Verkaufe zu tun. Zusätzlich zum Titel und Untertitel findet sich daher noch der Blurp aus L’Express auf dem Cover, in dem von Strategien die Rede ist. Man glaubt eine Auflistung von Tricks in der Hand zu halten, mit der man praktisch jedermanns Herz erobern kann. Aber so ist es nun wirklich nicht.
Wir haben es hier mit einem schönen Beispiel von strikt auf den Markt ausgerichteter Verkaufe zu tun. Zusätzlich zum Titel und Untertitel findet sich daher noch der Blurp aus L’Express auf dem Cover, in dem von Strategien die Rede ist. Man glaubt eine Auflistung von Tricks in der Hand zu halten, mit der man praktisch jedermanns Herz erobern kann. Aber so ist es nun wirklich nicht.
Tobie Nathan stammt aus Ägypten, lebt seit Jahrzehnten in Frankreich und ist dort einer der großen Intellektuellen. Psychologe, Ethnologe, und dann schreibt er auch noch Bücher und war als Kulturattaché in Israel und Guinea. Der gibt keine Tipps à la „Tragen Sie doch mal die Haare offen“. Nathan erzählt aus seiner Praxis im psychotherapeutischen Zentrum für Migranten, dessen Mitbegründer er ist. Dort hat er es immer wieder mit Menschen aus Kulturen zu tun, die ganz selbstverständlich daran glauben, dass Liebe erzeugbar ist. In Haiti können das Voodoo-Priester, und in Nordafrika gibt es den Geist Zar, der Menschen überwältigt und in einen Liebeswahn versetzt.
Nathans Patienten kennen einen solchen Liebeswahn. Ein Mann findet in seiner Sockenschublade ein kultisches Objekt, das seine Freundin dort versteckt hat, um Macht über ihn auszuüben. Eine Frau erliegt in Peru einer unvernünftigen Liebe, aus der sie nur ein Zaubertrank rettet. Eine andere schickt dem Mann, der sie verlassen hat, eine seltsame Konstruktion, woraufhin er krank wird. Schön schräg, das alles? Ja.
Nebenbei fächert Nathan bekannte und weniger bekannte Beispiele aus Mythologie und Literatur für den Liebeswahn auf. Wie König David, der sich in Batseba, die Frau seines Soldaten, verliebt. Und Tristan und Isolde, die versehentlich gemeinsam einen Liebestrank schlürfen und nicht mehr voneinander loskommen.
Mein letzter unglücklicher Liebeswahn ist erfreulich lange her, aber ich glaube, dieses Buch wäre damals perfekt für mich gewesen. Sonst fühlt es sich ja immer so an, als renne man gerade alleine in sein Unglück: Nur diese Liebe ist so groß, deshalb muss ich so leiden! Dabei leiden andere auch, und die Liebe stellt sich im Nachhinein manchmal als Strohfeuer heraus. „Wenn es weh tut, ist es keine Liebe“, sagte eine Freundin meiner Mutter oft. Ein Satz zum Merken.
Und die Tricks? Was ist mit den Tricks? Tja, die kommen ganz am Schluss, ein paar zumindest: Tobie Nathan glaubt tatsächlich, dass es hilft, die Geister anzurufen. Am besten dort, wo Menschen Bindungen eingehen: in der Kirche, in der Synagoge, im Standesamt. Außerdem möge man den anderen in suboptimaler Verfassung erwischen. Traurig könne er etwa sein oder sehr müde. Ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesen Empfehlungen halten soll. Sicher ist: Die Traurigen und Müden dieser Welt fand ich noch nie besonders anziehend.
Was jetzt? Ich kenne da jemanden, der ist gerade in genau der richtigen Verfassung für dieses Buch.
Tobie Nathan: „Verliebt machen. Warum Liebe kein Zufall ist“. Aus dem Französischen von Christiane Landgrebe. Berlin Verlag, Berlin 2014. 239 Seiten, gebunden, 19.99 Euro.
#18 – Catherine Alliott: „Heiratsfieber“
Provenienz: Tja, wie solche Bücher eben zu einem kommen. Im Zweifelsfall in der Bahnhofshalle gekauft.
Ungelesen seit: Ich dachte, acht Jahren. Aber dann kam alles ganz anders.
Welches Buch nimmt man mit, wenn man zu einer Beerdigung reist? Wenn man schon freundliche Weisheiten von echten Menschen mittels Lakonie abtropfen lässt und sicher nicht auch noch ein deprimierendes Buch brauchen kann? In dieser Situation entschied ich mich für „Heiratsfieber“ von Catherine Alliott. Und immerhin, deprimiert hat es mich nicht. Die Eckdaten: Die geschiedene Londonerin Annie will einen Arzt heiraten, reist aber vorher über die Sommermonate mit ihrer 12-jährigen Tochter Flora nach Cornwall, um einen Roman zu schreiben. (Die Romanfigur schreibt einen Roman! So meta!) Allerdings haben sich durch ein Versehen auch der Amerikaner Matt und dessen Sohn im selben Haus eingemietet, also muss es geteilt werden. Hier trapst die Nachtigall bereits gewaltig.
Was mir sofort auffiel, waren die unabsichtlichen Widersprüche im Buch. Die Tochter zum Beispiel wird eingeführt, wie sie zu spät in die Küche stürzt, ihre Schulsachen hinter der Tür vom Boden aufklaubt und mit wehenden Haaren zum Schulbus rennt. Wenige Seiten später heißt es, Flora wäre ja so gut organisiert und ordentlich. (Das stimmt immerhin im Gegensatz zu Annie, die – total originell für das Genre – eine liebenswerte Schlunze ist.) Weiterhin heißt es, das Haus in Cornwall habe direkten Zugang zum Meer, aber später liegt es plötzlich ein gutes Stück landeinwärts. Und als Annie erwägt, ein weiteres Kind zu bekommen, freut sich ihre Schwester, dass sie ihr dann endlich mal Ratschläge geben kann – dabei hat Annie doch schon ein Kind.
Mein absolutes Highlight war allerdings der Name von Matts Sohn: Tod. Man sollte meinen, da hätte rechtzeitig jemand eingegriffen und gesagt: ‚In der deutschen Übersetzung nennen wir ihn besser Todd, die Schreibweise kennt man dort, und es hat nicht diese Konnotation von, nun ja, Verwesung.‘ Aber nein. So kommt es zu Perlen wie: „Von Tod keine Spur.“
Das Geschehen plätschert so vor sich hin. Wer einmal einen Frauenroman gelesen hat, kann es sich ungefähr vorstellen – das ist ein bisschen wie bei Western: Kennste einen, kennste alle. Und irgendwann, etwa nach 400 Seiten, fiel es mir auf: Ich hatte dieses Buch schon einmal gelesen. Da kam nämlich eine psychologische Komponente ins Spiel, die in etwa besagt: Der Typ, der richtig für dich war, als es dir schlecht ging, ist nicht unbedingt der richtige, wenn es dir wieder gut geht. Das habe ich mir damals gemerkt, weil es mir plausibel schien. Der Rest des Buches war vollständig aus meiner Erinnerung gelöscht und durch ABBA-Songtexte ersetzt worden. Wie praktisch. Wenn das Buch nicht so voller Schlampereien und sprachlicher Plumpheiten wäre, könnte ich es glatt in acht Jahren nochmal lesen.
Was jetzt? Das Buch kommt weg. Entweder auf das Verschenk-Fensterbrett im Treppenhaus oder gleich in den Papiermüll.
Catherine Alliott: „Heiratsfieber“. Roman. Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck. Blanvalet Verlag, München 2006. 544 Seiten, Taschenbuch, vergriffen.
Disclaimer: Ich veröffentliche auch bei Blanvalet. Ich konnte allerdings keinerlei Befangenheit in mir finden.
#14 – Ildikó von Kürthy: „Sternschanze“
Provenienz: geschenkt bekommen – es ist gerade erst erschienen. Damit ist es streng genommen keines der 45 aus meinem guten Vorsatz (genau wie „Dr. Sex“), aber man sollte ja auch nichts vor sich herschieben, nicht wahr. Vielleicht nehme ich mir dafür die Freiheit, die drei Geschichten von Edgar Wallace in einem Band auszulassen. Es sei denn, mir fällt wieder ein, warum ich die gekauft habe.
Ungelesen seit: zehn Stunden. Und dann sofort ausgelesen.
 Ildikó von Kürthy gehört zu den Autoren, denen man heute dringend zu einem Pseudonym raten würde. Dass sie keines hat, finde ich hochsympathisch. Außerdem habe ich mal in der „Zeit“ von einem Telefongespräch mit ihr gelesen, während dessen sie gefragt wurde, ob sie eigentlich nicht lieber anspruchsvolle Bücher schreiben würde. Sie antwortete sinngemäß, Walser sei ja auch nicht traurig, dass er keine witzigen Frauenromane schreiben könne. Oder war es Mosebach? Egal, ihr versteht schon. Mir gefällt diese Argumentation ausgesprochen gut, schließlich ziert mein erstes Buch ein rosa Cover, und zum Bachmann-Preis werde ich damit auch nicht eingeladen. Meine Trauer darob hält sich in Grenzen.
Ildikó von Kürthy gehört zu den Autoren, denen man heute dringend zu einem Pseudonym raten würde. Dass sie keines hat, finde ich hochsympathisch. Außerdem habe ich mal in der „Zeit“ von einem Telefongespräch mit ihr gelesen, während dessen sie gefragt wurde, ob sie eigentlich nicht lieber anspruchsvolle Bücher schreiben würde. Sie antwortete sinngemäß, Walser sei ja auch nicht traurig, dass er keine witzigen Frauenromane schreiben könne. Oder war es Mosebach? Egal, ihr versteht schon. Mir gefällt diese Argumentation ausgesprochen gut, schließlich ziert mein erstes Buch ein rosa Cover, und zum Bachmann-Preis werde ich damit auch nicht eingeladen. Meine Trauer darob hält sich in Grenzen.
Vor der Lektüre war ich also ausgesprochen positiv voreingenommen. In „Sternschanze“ geht es um Nicola, deren Mann Oliver unlängst fett Karriere gemacht hat. Sie selbst hat ihren Job aufgegeben. Jetzt gehören sie zur Hamburger High Society, wo Oliver sich ausgezeichnet macht, Nicola sich aber grässlich unwohl fühlt. Weil er sie vernachlässigt, verknallt sie sich bei einer zufälligen Begegnung in einen alten Bekannten und beginnt eine Affäre. Ein halbes Jahr gibt sie sich Zeit zum Nachdenken, ob ihre Ehe Bestand haben soll.
Weil Nicola aber ein ausgesprochener Pechvogel ist, fliegt sie auf, und zwar in der denkbar unwürdigsten Art und Weise. Die Entscheidung ist ihr damit abgenommen; jetzt muss sie schauen, wie sie ohne das Penthouse und den Gatten klar kommt. Eine kleine Robinsonade also, wobei Nicola nach kurzer Verzweiflung vieles in den Schoß fällt. Etwas realistischer hätte das nach meinem Geschmack durchaus sein können.
Ildikó von Kürthy hat eine ungewöhnliche Erzählweise gewählt: zwei vor, eins zurück. Die Kapitel enden fast alle vor einer spannenden Entwicklung, die dann aber übersprungen wird. Das nächste Kapitel beginnt schon zwei Schritte weiter, greift aber im letzten Drittel noch einmal zurück und erzählt en passant, was passiert ist. Um dann wieder den nächsten Schritt auszulassen. Das klingt kompliziert und macht Menschen, die es linear mögen (zum Beispiel Männer!), wahrscheinlich nach kurzer Zeit wahnsinnig. Aber es führt eben auch dazu, dass man immer weiter lesen will. Sehr clever, wirklich.
Ihren Wortwitz lässt Ildikó von Kürthy hier eher selten aufblitzen. Es gibt ein paar amüsante Anekdoten wie die der Weihnachtsgans, in der die Innereien-Tüte vergessen wurde, aber der Grundton ist eher melancholisch. Nicola schlägt sich nämlich auch noch mit der Sehnsucht nach ihren verstorbenen Eltern, vor allem nach dem Vater, herum. Ein ziemlich großes Päckchen für die Heldin eines Frauenromans. Für Klamauk bleibt da wenig Platz, es ist eher wie Bridget Jones in Moll. Und ja, das ist ein Kompliment.
Was jetzt? Kommt neben Bridget Jones. Zusammen ergeben sie einen schön schrägen Akkord.
Ildikó von Kürthy: „Sternschanze“. Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg 2014. 346 Seiten, gebunden, 17.95 Euro.
#13 – T.C. Boyle: „Dr. Sex“
Provenienz: Ein mir nahestehender Herr hat es aussortiert, und ich habe zugegriffen.
Ungelesen seit: zwei Wochen
 Alfred Kinsey, der große Sexualforscher, ist tot – und sein engster Mitarbeiter John Milk und dessen Frau Iris streiten sich kurz vor der Beerdigung. Das ist der Prolog, und er erfüllt seinen Zweck prima: Es klingt, als hätte Kinsey im Laufe der Zeit einen Keil zwischen die Eheleute getrieben, und ich wollte sofort wissen, wie.
Alfred Kinsey, der große Sexualforscher, ist tot – und sein engster Mitarbeiter John Milk und dessen Frau Iris streiten sich kurz vor der Beerdigung. Das ist der Prolog, und er erfüllt seinen Zweck prima: Es klingt, als hätte Kinsey im Laufe der Zeit einen Keil zwischen die Eheleute getrieben, und ich wollte sofort wissen, wie.
Wir befinden uns im Amerika der Fünfziger Jahre; einer Ära, zu der in den meisten Gehirnen wahrscheinlich sofort das Wort „prüde“ erschallt. Manche schreiben entsetzte Briefe à la „Mein Mann will mich da unten küssen, das ist doch sündig“; andere wiederum leben ein sexuell ausschweifendes Leben – so wie Kinsey selbst. Ein klares Sittengemälde wäre schön gewesen, aber T.C. Boyle bleibt schwammig. Die Aussage lautet also: Manche sind prüde, andere nicht. Man könnte sie zu jedem Zeitpunkt über jede Gesellschaft treffen.
Boyle erzählt die Geschichte aus der Perspektive von John Milk, der einzigen fiktionalen Figur des Kreises um Professor Kinsey. Milk heuert als Student an bei „Prok“, wie der Forscher genannt wird, und beginnt sowohl mit ihm als auch mit seiner Frau Mac ein sexuelles Verhältnis. Parallel verliebt er sich in eine Kommilitonin, die er später heiratet.
Wie man sich vorstellen kann, geht das nicht gut zusammen. Prok verhält sich bei allem Charme und Geistesreichtum fürchterlich dominant und redet seinen Mitarbeitern in die privatesten Angelegenheiten hinein – auch, mit wem sie Sex haben sollten. Iris dagegen ist, obwohl in der Auswahl ihrer Sexualpartner konservativer als alle anderen, der größte Freigeist von ihnen. Sie denkt nicht daran, vor Prok zu kuschen. John Milk ist hin- und hergerissen zwischen diesen beiden starken Persönlichkeiten.
Nebenbei erzählt T.C. Boyle von der Forschungsarbeit des Teams. Hierbei gilt: Die absurdesten Szenen sind historisch belegt. Zum Beispiel die Studie, für die Kinsey tausend Männer beim Onanieren filmte – vor allem um zu klären: Wie viele spritzen, wie viele tröpfeln eher? Ein Projekt nach dem Motto „L’art pour l’art“, scheint mir.
Die Forschung bietet dem Autor natürlich jede Menge spannende Details. Aber, was noch viel besser ist: Die Sprache leuchtet an manchen Stellen förmlich hervor. Boyle formuliert originell und ist ausgezeichnet übersetzt von Dirk van Gunsteren. Über eine Studentin, mit der Milk eine Vorlesung aufsucht, heißt es beispielsweise „[…] ich neben der sich putzenden Laura Feeney“, und ohne genau zu beschreiben, was sie tut, erklärt dieser Satz doch alles. Auch sehr erfreut war ich über die Wortschöpfung „Gerüchteköche“. Leider wurde mein Enthusiasmus kurz darauf vom Wort „Tischtennistisch“ gebremst.
Und das Versprechen des Prologs? So ganz wird es nicht eingelöst. Die Situation zwischen John und Iris ist nämlich deutlich weniger dramatisch, als es eingangs wirkte. Aber hey, besser als umgekehrt.
Was jetzt? Vielleicht stelle ich es neben Bukowski. Den würden die pikanten Details sicher brennend interessieren.
T.C. Boyle: „Dr. Sex“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser Verlag, München 2005. 472 Seiten, gebunden, 24.90 Euro.
#6 – Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“
Provenienz: Dieses Buch habe ich mir vor einem Toskana-Urlaub mit Freundinnen gekauft. Hatte herrliche Visionen davon, wie ich es am Pool liegend lesen würde. Es stellte sich aber heraus, dass meine Freundinnen noch bessere Unterhaltung bieten.
Ungelesen seit: knapp zwei Jahren
Der vollständige Name des Autors lautet Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, und alleine das nimmt mich schon für ihn ein. Seine Familie war frisch in den Adelsstand erhoben, als er geboren wurde. Der Mann war ein klassisches One-Hit-Wonder: 1782 schrieb er seinen einzigen großen Erfolg „Gefährliche Liebschaften“, im Original „Les Liaisons dangereuses“. Der französische Titel ist insofern treffender, als nicht nur Liebschaften gefährlich sind, sondern auch die Allianzen, die die Figuren eingehen.
Aber der Reihe nach: Die Welt dieses Romans teilt sich anfangs relativ klar ein in Gut (interessanterweise dem neuen Adel zugehörig, wie der Autor) und Böse (alter Adel). Das ist ja immer erfreulich, weil leicht zu erklären. Auf der einen Seite stehen die tugendhafte Madame de Tourvel, deren Gatte für längere Zeit im Ausland weilt, und die junge Cécile de Volanges, deren Mutter sie gerade aus der Klosterschule geholt hat, um sie mit dem Grafen Gercourt zu verheiraten. Zwei wirklich brave Mädchen. Dann gibt es noch Danceny, der Cécile Musikunterricht gibt. Die beiden verlieben sich ineinander, aber ihre Beziehung bleibt trotz aller Liebesschwüre unschuldig.
In der Ecke der Herausforderer: der Vicomte de Valmont, ein bekannter Frauenverführer und Tunichtgut, der sich zum Ziel gesetzt hat, Madame de Tourvel zu verführen. An seiner Seite kämpft die Marquise de Merteuil, die für Cécile de Volanges eine mütterliche Freundin ist und alles daran setzt, das junge Mädchen noch vor der Hochzeit moralisch zu Fall zu bringen. Denn der Graf Gercourt hat die Marquise einmal verlassen und ist seitdem ihr Erzfeind. Deshalb trachtet sie danach, seine jugendliche Braut zu verderben.
„Gefährliche Liebschaften“ ist ein Briefroman, und wenn man anderen Büchern vorwirft, sie seien konstruiert, so muss das hier als Kompliment gelten. Laclos hat zwei Ebenen geschaffen, die einander unterstützen: In den Briefen der Bösen an die Guten ist alles eine einzige Heuchelei; in den Briefen der Bösewichter untereinander legen sie ihre Machenschaften und niederen Beweggründe offen. Diese Briefe bieten immer wieder Überraschungen – und auch die Durchtriebenheit und fiesen Kniffe nötigten mir Respekt ab.
Dafür habe ich am Anfang immer mal wieder quer gelesen, denn die Liebenden machen mit schöner Ausdauer immer einen Schritt vor und einen zurück. Die Briefe sind voller Beteuerungen, Vorwürfe und unnötiger Dramatisierungen. Vielleicht muss man das Buch mit Anfang zwanzig lesen, in einer romantischen Phase, um dieses ganze Geblubber nicht über zu bekommen: „Ich werde mir immer einreden, Ihr Herz sei fühllos. Ich werde mir sogar Mühe geben, Sie nicht mehr so oft zu sehen, und halte jetzt schon Ausschau nach einem triftigen Vorwand. Wie? Ich soll die liebe Gewohnheit aufgeben, Sie tagtäglich zu sehen? Ach, wenigstens werde ich nie aufhören, mich danach zu sehnen! Ein Unglück ohne Ende wird der Lohn für die zärtlichste Liebe sein.“
Ächz. Nur die Briefe von Valmont und der Marquise, die sich über die romantischen Dummheiten der anderen mokieren, haben mich das ertragen lassen.
Das größte Vergnügen allerdings bieten die ausgefeilten Psychogramme, die das Buch zeichnet. Die Masken, mit denen alle hantieren, werden nach und nach abgerissen – und nicht immer ist das, was zum Vorschein kommt, schlecht. Trotzdem sind am Ende natürlich alle dem Elend geweiht. Es mag mich nicht in ein weiches Licht setzen, aber mich hat das zufrieden gemacht: Die Romantiker haben mich zuvor doch einigermaßen genervt, und die Intriganten haben es auch nicht besser verdient.
Was jetzt? Das bleibt bei mir. Ich suche noch einen netten Nachbarn für das Buch – vielleicht Jane Austen.
Choderlos de Laclos: „Gefährliche Liebschaften“. Roman. Aus dem Französischen von Walter Widmer. Harenberg, Dortmund 1986. 346 Seiten, gebunden, in dieser Ausgabe vergriffen.

