Kategorie: Leichtes
#45 – Nora Roberts: „Töchter des Windes“
Provenienz: vom Verlag zugeschickt bekommen
Ungelesen seit: fünf Monaten
Zufällig veröffentliche ich beim selben Verlag wie Nora Roberts, wo man um meine kleine Schwäche für sie weiß und mir deshalb ein Paket mit einer kleinen Auswahl ihres gewaltigen Œuvres gepackt hat. Falls ihr euch schon ewig fragt, wer den Scheiß eigentlich liest: ich. Ich les den Scheiß. Dafür brauche ich aber immer gute Gründe. Eine schwere Erkältung etwa bringt mich auf genau das richtige intellektuelle Level. Diesmal war es die Einrichtung und Renovierung meiner neuen Wohnung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Derzeit komme ich abends von der Redaktion nach Hause, zieh das Röckchen aus, die Handwerkerhose an und die Werkzeugkiste hinter mir her.
 Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Nach zehn Tagen dieser Art war ich mit dem Verkäufer in meinem liebsten Baufachhandel per Du und befürchtete, mir könne ein Penis wachsen. Sicher gibt es auch Frauen, die sich total in ihrer Weiblichkeit angekommen fühlen, wenn sie mit Bohrmaschine und Phasenprüfer auf einer Leiter stehen oder sich mit der Stichsäge unter die Spüle legen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fühle mich dabei eher wie ein Kerl mit Brüsten, und wie wir alle wissen, ist das nicht die attraktivste Sorte. Deshalb brauchte ich ein Gegengewicht. Irgendwas klischeehaft Kitschiges. Voilà.
Die Geschichte, tja. Kennste eine, kennste alle: Brianna führt eine Pension in Irland und ist eine rechtschaffene Unschuld vom Lande, wobei Unschuld auch noch ganz wörtlich zu verstehen ist. Dann mietet sich Grayson für einige Monate bei ihr ein, ein Amerikaner, der in der Abgeschiedenheit einen seiner blutrünstigen Thriller schreiben will. Er hat natürlich eine düstere Vergangenheit, Heimkind, Straßenjunge, Kleinkrimineller, ist jetzt aber vollkommen geläutert und noch dazu scheißreich, was der braven Brianna selbstverständlich überhaupt nichts bedeutet. Man kommt sich näher, sie heilt seine kaputte Seele mit der Kraft ihrer Liebe. Bin ich die einzige, die sich an „Fifty Shades of Grey“ erinnert fühlt? Es hat was davon, war aber erstens lange vorher da und ergeht sich zweitens eher in Kerzenschein-und-Flanellnachthemd-Erotik. Keine Peitschen, nirgends.
Was genau daran mich dazu treibt, bis zum Ende zu lesen? Ehrlich, ich hab keine Ahnung. Man weiß von Anfang an, wie es ausgeht, selbst die zweite große Krise ist völlig vorhersehbar. Das ist bei Genre-Romanen ja oft so, aber bei Nora Roberts hat man schon gelegentlich den Eindruck, sie tauscht von Buch zu Buch nur die Namen, den Schauplatz und die Berufe ihrer Figuren aus. Übrigens ist dies Teil zwei einer Trilogie, also nehme ich das mit dem Schauplatz zurück, denn es spielt alles in diesem Umfeld. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Wenn man sein Gehirn mal so richtig ausknipsen will, ist das perfekt. Als Kind hab ich immer wieder dieselbe Kasperleplatte gehört, wenn ich krank war, heute sind es eben leicht variierte Kitschromane. (Ja, da steht Platte. SCHALLPLATTE. So alt bin ich.)
Was jetzt? Ich verstecke es irgendwo im Bücherregal und deklariere es als Recherche.
Nora Roberts: „Töchter des Windes“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Uta Hege. Blanvalet Verlag, München 2014 (drölfzigste Auflage). 477 Seiten, Taschenbuch, 9.99 Euro.
#44 – Jonathan Franzen: „Unschuld“
Provenienz: Der Mann überreichte es mir, nachdem er mich vorher kaltblütig mit „Freiheit“ angefixt hatte.
Ungelesen seit: Etwa zwanzig Minuten. Ich bin wirklich angefixt.
 Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Um dieses Buch zu lesen, hatte ich eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt. Erst stand ein Umzug an, der mich die letzten Reste meines Verstandes kostete, und tags darauf warf mich eine Erkältung um. Meine Laune war also nicht gerade prächtig, als ich zwischen unausgepackten Umzugskartons röchelnd im Bett lag. Zwei Dinge retteten sie: Meine zwanghaft geführte Excel-Tabelle mit dem genauen Inhalt sämtlicher nummerierter Kisten, dank derer ich innerhalb von zwanzig Sekunden den Wasserkocher fand und immerhin Tee kochen konnte. Und dieses Buch, dessen Lektüre ich nur unterbrach, um stundenlang komatös zu schlafen.
Der Titel rührt vom Namen der Protagonistin her, Purity, genannt Pip. Eine junge Frau mit widerständigem Geist, haufenweise Studienschulden und einer anstrengenden Mutter. Pip hasst ihren Job, wohnt in einem besetzten Haus und ist unglücklich in einen der Mitbewohner verliebt. In dieser desolaten Situation erhält sie das Angebot, nach Bolivien zu reisen und für eine Organisation zu arbeiten, die entlarvende Regierungsdokumente ebenso online stellt wie Zahnarztskandälchen. Sie fährt hin, sie lernt einen Mann mit zwei Gesichtern kennen, und sie findet im Anschluss heraus, wer ihr stets totgeschwiegener Vater ist. Ich unterschlage jetzt mal sämtliche Details, ihr sollt es schließlich selbst lesen.
Franzen zeichnet seine Figuren sehr plastisch, und er nimmt sich viel Zeit dafür. Über jedermanns Vergangenheit erfahren wir viel, es wird ausgiebig erzählt, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Das ist super, das hätte ich fürs richtige Leben auch gerne. Jemanden, der neben mir hergeht und Dinge sagt wie: „Dein neuer Kollege hat als Kind lange ins Bett gemacht, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hat. Er ist zutiefst unsicher, deshalb wirkt er wie ein arroganter Saftsack.“ Wäre das schön. Und so praktisch! Mein einziger Kritikpunkt an der Geschichte ist, dass mir die Kombination „Alter Mann trifft junge Frau, doch nach ein paar Jahren wird es zäh“ ein bisschen zu oft in leichten Variationen vorkam.
Aber. ABER! Die Übersetzung. Es ist das Grauen. Tut mir leid. Denn eigentlich fallen durchaus wunderschöne Sätze in „Unschuld“. Diese zum Beispiel:
Als arbeitende Journalisten in einer Studentenschaft, die sich nach Studentenmanier vergnügte, erreichten meine Freunde und ich ein Selbstgefälligkeitsniveau, wie es mir erst wieder unterkommen sollte, als ich Mitarbeiter der New York Times kennenlernte. Natürlich hatten wir alle einen Nougatkern der Unschuld, aber jeder prahlte mit seinen sexuellen Großtaten an der Highschool, und dass meine Freunde womöglich logen – ich tat es ja schließlich auch –, dämmerte mir nie.
Nougatkern der Unschuld, hach. Und jetzt kommen wir zu den Negativbeispielen. Es fängt damit an, dass Pip und ihre Mutter besonders geruchsempfindlich sind. „Smell is hell“, sagen sie im amerikanischen Original. Und im Deutschen? „Geruch ist Fluch.“ Waaaahhh! Das reimt sich nicht! Nicht mal im Ansatz! Das macht mich völlig fertig. Was war die Alternative, wenn die Übersetzer das für die beste Lösung hielten? „Riechen ist Siechen“? „Gestank ist Punk“? „Odeur macht’s mir so schwör“? Halten wir fest: Man hätte das einfach gar nicht übersetzen müssen. Schließlich sind auch ganze Sätze auf Spanisch nicht übersetzt. Man versteht das schon, Himmelherrgott.
In Relation dazu ist der Rest Kleinkram, über den man beim Lesen trotzdem stolpert. „Er rümpfte die Brauen“ etwa missfiel mir außerordentlich. Außerdem schreibt der Godfather of Internetenthüllungen in Mails an Pip dauernd LOL. LOL. Wie so ein Teenager anno 2005. „Ihre Mail ist LOL“ – das ist nicht nur miese Grammatik, sondern auch noch peinlich. ROFLCOPTER hätte ich immerhin noch als Ironie durchgehen lassen.
Sehr seltsam mutet auch die Beschreibung an, wie bei der Arbeit am Computer „alle Frauen […] mausten und klickten“. Ich kenne mausen durchaus als Verb, aber in dieser Bedeutung ist es mir noch nie untergekommen. Außerdem kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, die bedeutungsarme Tätigkeit des bloßen Umherschiebens der Maus, bis man wieder eine ihrer Tasten betätigt, habe überhaupt kein eigenes Verb verdient. Diese Stellen haben mich fürchterlich geschmerzt, aber sie können das Buch nicht ruinieren. Ein Glück. Lest es.
Was jetzt? „Die Korrekturen“. Ganz klar.
Jonathan Franzen: „Unschuld“. Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Hamburg 2015. 832 Seiten, gebunden, 26.95 Euro.
#41 – Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“
Provenienz: selbst gekauft, weil: Wolf Haas!
Ungelesen seit: ein oder zwei Jahren
 Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Meine letzte Eloge auf Wolf Haas ist gar nicht allzu lange her. Und dies wird auch eine, aber ganz anders. Denn die Sprache, von der ich geschwärmt habe, kommt hier nur in einem Kapitel vor. Diesmal spielt Haas mehr mit dem Text als mit der Grammatik. Das Ergebnis hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte dauernd dem Mann irgendwas im Buch zeigen, aber nach drei Stellen hab ich es dann doch gelassen und ihm gesagt, er soll es selbst lesen – unbedingt!
Auch hier möchte ich nicht zu viel der phantastischen kleinen Ideen verraten, die in diesem Buch stecken. Nur die erste, die wie eine Einführung wirkt: Benjamin Lee Baumberger, der Protagonist und beste Freund des Erzählers, irrt durch einen Markt in England, wo er sich gerade unglaublich in eine Burgerverkäuferin verliebt hat. Er sucht sie, um sie abzuholen und den Abend mit ihr zu verbringen, doch er geht zuerst geradeaus und biegt dann links ab – und der Text, eine einzelne Zeile auf der Seite, macht dasselbe.
Das ist natürlich ganz schön verspielt und schreckt wahrscheinlich den Klassiker-Leser eher ab. Ich fand es großartig. Diese Seiten machen mehr aus der Geschichte, es ist wie ein kleines Sketchbook. Apropos Geschichte, da war doch was. Also: Wenn Benjamin Lee Baumberger sich verliebt, bricht fast immer in seiner Nähe eine Seuche aus. BSE, Vogelgrippe, Schweinepest: Er ist immer mittendrin statt nur dabei. Hier schlägt sich die Liebe der Österreicher zum ständigen Thematisieren von Krankheiten, diese seltsame Volkshypochondrie, literarisch aufs Schönste nieder. (Ja, das ist ein Pauschalurteil. Liebe Österreicher ohne hypochondrische Anwandlungen: Meldet euch gerne bei mir und beweist mir, dass ich falsch liege.)
Zum Glück verliebt Benjamin Lee sich zwischenzeitlich sehr lange nicht: Er ist in festen Händen. Das ist die Phase, in der der Erzähler sich mit ihm anfreundet und sich auch gleich noch in seine Frau verguckt. Als Benjamin Lee sich in Peking die Vogelgrippe einfängt und mit einer Holländerin vorübergehend verschwindet, versucht der Erzähler die besorgte Ehefrau zu trösten, löst aber unabsichtlich die finale Ehekrise aus.
Ganz, ganz wunderbar fand ich auch, dass Haas statt atmosphärischen Beschreibungen oft einfach nur [LONDON, FRISUREN, MODE] oder [BESCHREIBUNG DER BRÜCKE] einfügt. Diese Stellen kenne ich als Autorin nur zu gut, aber die Chuzpe, daraus einen Running Gag zu machen, muss man erst mal haben. Meine Lieblingsstelle ist [PARKATMOSPHÄRE EINFÜGEN. BÄUME UND LEUTE ETC. EVTL. VON BRUNO SCHREIBEN LASSEN. ODER VON HELGA, FALLS SIE SCHON WIEDER DA IST].
Das hat mich ein bisschen an diesen Tweet erinnert:
Was jetzt? Als nächstes muss es der Mann lesen, und dann werde ich es etwa drölfzigtausend Mal nachkaufen und verschenken.
Wolf Haas: „Verteidigung der Missionarsstellung“. Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 239 Seiten, gebunden, 19.90 Euro.
#40 – Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“
Provenienz: Geschenkt bekommen.
Ungelesen seit: drei Jahren
 Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Hoffentlich merkt ihr nicht zu deutlich, wie ich es momentan gerade so schaffe, am Ende des Monats wenigstens einen Buchtext hier zu veröffentlichen. Es ist einfach viel los. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon Anfang oder Mitte des Monats gelesen – und auch schon in einem Podcast darüber erzählt (Spoilerwarnung!).
Jedenfalls wirkt „Die Frau des Zeitreisenden“ von außen fröhlich, geradezu trivial. Das hat der Roman mal wieder dem Klappentext zu verdanken: „Clare fällt aus allen Himmeln, jedes Mal aufs Neue, wenn Henry vor ihr steht. […] Seine Zeitreisen sind das brennende Geheimnis, das Henry und Clare mit jeder Trennung noch inniger vereint.“ Brennendes Geheimnis? Geht’s noch? Groschenroman, ick hör dir trapsen. Solche Sätze hat das Buch nicht verdient!
Tatsächlich handelt es sich um eine romantische Liebesgeschichte, die erstaunlich wenig creepy ist, obwohl sie alle Zutaten hätte. Schließlich besucht der Zeitreisende Henry seine Frau Clare, als jene noch ein Kind und später ein junges Mädchen ist, das ihn unbedingt verführen möchte. Das klappt erst spät, dann allerdings haben die beiden dauernd Sex, unentwegt, es ist fast etwas redundant, aber gut, wir halten fest: Sie begehren einander sehr.
Und dann wird es heikel. Ich kann leider nicht allzu viel verraten, jedenfalls wird diese fröhliche, beseelte und leicht paranormale Liebesgeschichte ganz langsam ausgebremst. Es deutet sich an, aber weil ich das überhaupt nicht glauben mochte, habe ich natürlich doch bis zum Schluss gelesen. Hätte ich das doch mal besser gelassen.
Romantiker! Lest das Buch, klappt es in der Mitte zu, denkt euch irgendwas von „Happily ever after“ und geht einen Tee trinken. Lest nicht weiter. Ehrlich jetzt, hört auf meinen Rat, ich meine es nur gut.
Und für jene von euch, die eine Axt suchen für das gefrorene Meer in sich: Dieses Buch ist aber so was von eine Axt. Tretet beiseite, wenn die Späne fliegen.
Was jetzt? Ich behalte es, aber das kommt in die „Handle with care“-Ecke.
Audrey Niffenegger: „Die Frau des Zeitreisenden“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2004. 825 Seiten, geb., 10 Euro.
#39 – Khalil Gibran: „Der Prophet“
Provenienz: Geschenk von Oma
Ungelesen seit: etwa sieben Jahren
 Wo „spirituelles Kultbuch“ draufsteht, ist ja nun wirklich Vorsicht angezeigt. So auch bei diesem: Khalil Gibran war Libanese, emigrierte in die Vereinigten Staaten und bediente dort die Eso-Klientel, die es offenbar schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab. 1931 ist der Gute gestorben, aber, lächelt und seid froh: Er hat uns dieses Buch hinterlassen.
Wo „spirituelles Kultbuch“ draufsteht, ist ja nun wirklich Vorsicht angezeigt. So auch bei diesem: Khalil Gibran war Libanese, emigrierte in die Vereinigten Staaten und bediente dort die Eso-Klientel, die es offenbar schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab. 1931 ist der Gute gestorben, aber, lächelt und seid froh: Er hat uns dieses Buch hinterlassen.
Der rote Faden ist schnell erzählt: Ein Prophet hat zwölf Jahre lang in einer Stadt gelebt, doch nun muss er sie verlassen, weil sein Schiff kommt und ihn zurück in seine Heimat bringen wird. (Das muss ich mir merken für Konferenzen – in Momenten unerträglicher Langeweile sagen: „Oh, mein Schiff kommt!“ Und dann einfach aufstehen und gehen. Pure Grandezza.)
Die Stadtbewohner wollen ihn aber nicht einfach so gehen lassen, sondern noch ein paar Weisheiten abgreifen. Über den Genuss spricht der Prophet auf Nachfrage, über die Arbeit der nächste, über das Geben, über die Liebe. Das ist alles appetitlich in Kapiteln portioniert, die kann man immer mal anlesen und gucken, ob es zur Erleuchtung führt.
Ihr merkt vielleicht schon: Meins ist das nicht. Als Gründe für meine hochgezogene Augenbraue möchte ich exemplarisch die folgenden Sätze ins Feld führen.
Denn in Wahrheit ist es nur das Leben, das dem Leben gibt – während du, der du dich für einen Gebenden hältst, ein bloßer Zeuge bist.
Denn Müßigsein bedeutet, sich den Jahreszeiten zu entfremden und die Prozession des Lebens zu verlassen, das majestätisch und in stolzem Gehorsam auf die Unendlichkeit zuschreitet.
Vieles in euch ist noch menschlich, und vieles ist noch nicht Mensch, sondern ein ungeschlachter Zwerg, der im Schlaf durch den Nebel irrt auf der Suche nach seinem Erwachen.
Wenn ich mich davon angesprochen fühlte, würde ich mich ganz dringend um Psychopharmaka bemühen.
Aber auch in diesem Buch gibt es etwas Tolles: das Kapitel über die Kinder. Das ist womöglich einigermaßen berühmt, jedenfalls haben meine Großeltern das sehr gemocht und in den Flur gehängt. Deshalb ist es mir schon lange ein Begriff. Als Kind bin ich nicht mal über den zweiten Satz hinaus gekommen, der Anfang lautet nämlich: „Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.“
Jetzt habe ich selbst eine Familie und würde das meiste davon unterschreiben. Im Wesentlichen geht es um das, was der Anfang bereits andeutet: Die Kinder gehören euch nicht, vergesst das nie. „Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. […] Ihr dürft danach streben, ihnen ähnlich zu werden, doch versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. [...] Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile abgeschnellt werden.“
Diesen Teil finde ich wirklich berührend und bedenkenswert, während der Rest mich doch recht umfassend langweilte. Abgesehen von einem einzigen weiteren Gedanken; da geht es um das Spannungsverhältnis von Vernunft und Leidenschaft, das mir durchaus bekannt ist. Da werden beiden wirklich gute Rollen zugeordnet: Die Leidenschaft ist das Segel eines Bootes, und die Vernunft ist das Ruder. Nur auf die Vernunft zu hören, heißt: nicht vorwärts kommen. Und nur auf die Leidenschaft - nun, an diesem unwegsamen Ufer sind wir wahrscheinlich alle schon mal gestrandet.
Was jetzt? Das Kapitel über die Kinder hat die Existenz dieses Buches in meinem Haushalt gerettet.
Khalil Gibran: „Der Prophet“. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Mit Kalligraphien von Hassan Massoudy. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2007. 125 Seiten, broschiert, 5 Euro.
#38 – Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder“
Provenienz: Ich wollte ein Buch von Kaléko verschenken. Ganz aus Versehen kaufte ich dann gleich noch ein zweites. Für mich.
Ungelesen seit: etwa einem Jahr
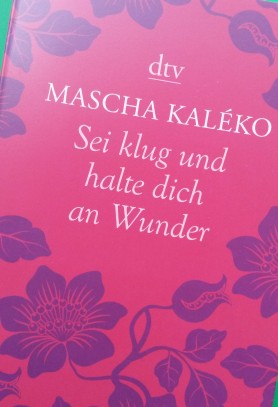 Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
Mascha Kaléko hat eines meiner langjährigen Lieblingsgedichte geschrieben: „Das berühmte Gefühl“; es handelt von Liebeskummer. Deshalb ist mir selbst rätselhaft, warum ich nicht schon früher mehr von ihr gelesen habe. Nun aber dieses. „Sei klug und halte dich an Wunder“ ist ein Potpourri aus Gedichten, Notizen und Tagebucheinträgen, und sie vollziehen auf wenigen Seiten ihr Leben nach: von der jungen, optimistischen Frau zur Verliebten, zur Mutter und zur bedrückten Jüdin, die sich um das Überleben ihres Volkes sorgt. Sie selbst ist 1938 aus Berlin in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Am Ende wirkt Kaléko abgeklärt, fast resigniert. Es ist gar nicht so einfach, das nach dem stürmischen Beginn zu verkraften.
So sehr ich Lyrik liebe, so wenig kann ich meist mit zeitgenössischer Dichtung anfangen. Was ich mag, endet mit wenigen Ausnahmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das war eine goldene Zeit, selbst wenn man nur die populärsten Dichter Kästner, Ringelnatz und Tucholsky berücksichtigt. Mit letzterem übrigens hat Mascha Kaléko die größte Ähnlichkeit. Wie Tucholsky ist sie zugleich lebensklug, gefühlvoll und auf eine lakonische Art sehr, sehr witzig. „Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an!“, schrieb Tucholsky selbst über sie.
Und das war sie, fürwahr. Kommen wir zu den Belegen! In „Ausverkauf in gutem Rat“ etwa schreibt sie:
Denn: So einer in Not ist,
bekommt er immerfort
guten Rat. Seltener, Whisky.
Ganz wunderbar fand ich auch diesen Vierzeiler:
Halte dein Herz an der Leine
Das ist vernünftig, mein Sohn!
(Aber, ganz ehrlich: das meine
Lief mir noch immer davon.)
Wenn endlich mal jemand die Seufzertaste für die Tastatur erfinden würde, könnte ich meine Gefühle in solchen Fällen angemessen zum Ausdruck bringen. So bleibt mir nur, zu schreiben: Lest Mascha Kaléko! Ihr alle! Ihr werdet es nicht bereuen. Ehrlich.
Was jetzt? Regalbrett „Lieblingsdichter“.
Mascha Kaléko: „Sei klug und halte dich an Wunder. Gedanken über das Leben“. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2013. 170 Seiten, Taschenbuch, 7.90 Euro.
#37 – Karen Russell: „Vampire im Zitronenhain“
Provenienz: zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen. Glaube ich.
Ungelesen seit: zehn Monaten
 Manchmal muss man eben gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also: Dies ist die beste Zusammenstellung von Erzählungen, die ich jemals gelesen habe. Karen Russell ist Jahrgang 1981 und gilt zu Recht als eine der besten Nachwuchsautorinnen der Vereinigten Staaten. Auf der Rückseite des Buches schaut sie etwas zaghaft aus der Wäsche, aber das täuscht. In ihrem Kopf geht nämlich ganz schön die Post ab.
Manchmal muss man eben gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also: Dies ist die beste Zusammenstellung von Erzählungen, die ich jemals gelesen habe. Karen Russell ist Jahrgang 1981 und gilt zu Recht als eine der besten Nachwuchsautorinnen der Vereinigten Staaten. Auf der Rückseite des Buches schaut sie etwas zaghaft aus der Wäsche, aber das täuscht. In ihrem Kopf geht nämlich ganz schön die Post ab.
„Vampire im Zitronenhain“ hebt sich von anderen Erzählungsbänden unter anderem durch die aberwitzige Vielfalt von Welten ab, die Russell ersonnen hat. Wir kennen es ja alle, dass in einem Buch jede Kurzgeschichte klingt, als widerfahre sie dem Nachbarn des Protagonisten der vorhergehenden Seiten. Das kann seinen Charme haben. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, bevorzuge ich den wilden Ritt durch Karen Russells erstaunliche Erfindungsgabe.
Der Titel zum Beispiel. Der mag metaphorisch klingen, aber es geht in der ersten Erzählung tatsächlich genau darum: einen Vampir, der in einem Zitronenhain lebt. Weil er kein Blut mehr trinkt, sondern Zitronensaft. Erst spät hat er gelernt, dass er kein Blut braucht, dass Knoblauch ganz lecker und Sonnenlicht kein Problem ist. Seine Gefährtin hingegen macht durchaus Probleme. Man ist sich nicht mehr in allem so einig wie noch vor einigen hundert Jahren.
Die nächste Geschichte ist eine recht konventionelle Teenager-Story, dann folgt ein Ausflug ins Grusel-Genre, dann eine bitterböse Satire über ehemalige amerikanische Präsidenten, die nach ihrem Tod als Pferde in einem Stall wieder zu sich kommen. Anschließend ein Ausflug zu den jährlichen Nahrungskettenspielen in der Antarktis, Team Wale gegen Team Krill. Genau so geht es weiter, eine ungewöhnliche Idee reiht sich an die andere. Völlig ausgeflippt? Aber ja doch. Großartig!
Von ihrer unerschöpflichen Phantasie mal abgesehen, hat Karen Russell auch ein besonderes Talent für erste Sätze. Was für ein Glück, dass sie keinen Roman geschrieben hat – sonst gäbe es nur einen davon! So aber beginnen die Erzählungen wie folgt:
Im Oktober ernten die Männer und Frauen von Sorrent den primofiore oder die „Frucht der ersten Blüte“, die besonders saftigen Zitronen; im März reifen dann die hellgelben bianchetti und im Juni die grünen verdelli.
Oder auch:
Man mag sich fragen, wozu es Regeln für die Fanveranstaltungen geben soll, wenn die Nahrungskettenspiele selbst eine gesetzlose Metzelei sind.
Mein Lieblingseinstieg lautet:
Etliche von uns behaupten, Tochter eines Samurai zu sein, aber nachprüfen lässt sich das natürlich nicht mehr.
Ich mag besonders den alltäglichen Tonfall, mit dem Russell die irrsinnigsten Dinge beschreibt. Das hat mich an Douglas Adams erinnert. Vielleicht auch, weil sich so ein feinsinniger Humor durch die Geschichten zieht. Ich bin jedenfalls schwer begeistert und will mehr: Von Karen Russell sind bereits zuvor zwei Bücher auf Deutsch erschienen. Hurra!
Was jetzt? Das kommt auf eines der Regalbretter mit den meistgeliebten Büchern.
Karen Russell: „Vampire im Zitronenhain“. Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Malte Krutzsch. Kein & Aber, Zürich/Berlin 2013. 319 Seiten, gebunden, 19.90 Euro
#36 – Elke Heidenreich und Bernd Schroeder: „Rudernde Hunde“
Provenienz: aus der großen Schenkung zu meinem Dreißigsten
Ungelesen seit: fast drei Jahren. Äh, ich meinte: kurz. Ganz kurz. Mein Dreißigster war eigentlich erst gestern.
 Wir haben es hier mal wieder mit Kurzgeschichten zu tun. Wobei, eigentlich trifft es „kurze Geschichten“ besser. Manche sind nur Miniaturen, manche entwickeln eine richtige Handlung, manche sind erdacht, manche tatsächlich so passiert. Und genau an diesem letzten Punkt krankt das Buch leider.
Wir haben es hier mal wieder mit Kurzgeschichten zu tun. Wobei, eigentlich trifft es „kurze Geschichten“ besser. Manche sind nur Miniaturen, manche entwickeln eine richtige Handlung, manche sind erdacht, manche tatsächlich so passiert. Und genau an diesem letzten Punkt krankt das Buch leider.
Heidenreich und Schroeder haben nämlich nicht markiert, welche Geschichten echt sind. Man kann es sich teilweise denken, weil immer mal wieder ein Text so dramatisch abfällt. Zum Beispiel „Trachtenmode“, der erzählt, wie ein paar deutsche Dokumentarfilmer ein Känguru anfahren und einer ihm zum Spaß seine Jacke anzieht und es so fotografiert. Plötzlich schreckt das Känguru auf und rennt davon. Natürlich befinden sich in der Jacke das ganze Geld und die Flugtickets. Ende der Geschichte. Zugegeben: Das wäre eine super Anekdote in einer Kneipe – wenn sie denn wirklich echt ist, was ich nur vermuten kann. Aber so steht sie seltsam da im Vergleich zu den anderen Texten.
Lustigerweise beschreibt das Buch sein eigenes Dilemma. Es geht da um einen Großvater, der immer alles Mögliche erfindet und so erzählt, als sei es wirklich passiert. „Ich begriff durch den Großvater, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob Geschichten wahr sind. Gut erfunden müssen sie sein.“ Voilà!
Daneben gibt es übrigens wirklich reizende Geschichten. Etwas zu viele sprechende Tiere kamen für meinen Geschmack vor, aber was soll’s. Wenn der alte Hund von Rudolf Nurejew nach dessen Tod plötzlich anfängt, Ballettposen einzuüben, wenn ein Paar sich über die Renovierung des Hauses entzweit, wenn eine Frau sich ihres Verehrers durch plötzliches Abtauchen entledigt – das ist alles sehr hübsch und leichtfüßig. Es verleiht der Kategorie „Leichtes“ in diesem Blog jedenfalls eine völlig neue Dimension.
Was jetzt? Das bleibt. Sicher werde ich gerne mal wieder darin lesen.
Elke Heidenreich und Bernd Schroeder: „Rudernde Hunde“. Geschichten. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, September 2006. 252 Seiten, gebunden, 8 Euro.
#34 – Gernhardt, Eilert, Knorr: „Erna, der Baum nadelt!“
Provenienz: aus dem tollen Buchpaket zu meinem Dreißigsten
Ungelesen seit: zweieinhalb Jahren
 Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da in die Hand nehme. Robert Gernhardt geht bei mir immer, und die weihnachtliche Anmutung barg eine gewisse Dringlichkeit, das nun nicht bis in den Sommer hinein liegen zu lassen. Es zeigte sich: „Ein botanisches Drama am Heiligen Abend“ ist schnell gelesen. Zumindest beim ersten Mal.
Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da in die Hand nehme. Robert Gernhardt geht bei mir immer, und die weihnachtliche Anmutung barg eine gewisse Dringlichkeit, das nun nicht bis in den Sommer hinein liegen zu lassen. Es zeigte sich: „Ein botanisches Drama am Heiligen Abend“ ist schnell gelesen. Zumindest beim ersten Mal.
Wie der Titel verheißt, geht es um einen plötzlich nadelnden Christbaum. Der steht bei der Familie von Erna und Schorsch Breitlinger, die anfangs entsetzt sind und Nachbarn zu Hilfe rufen. Alle anderen sind auch entsetzt, so dass die Breitlingers schließlich eher stolz sind auf dieses Phänomen und der Presse gern für ein Foto zur Verfügung stehen. Bis das frohe Ereignis nach einer Weile so schnell zu Ende ist, wie es begonnen hat.
Das Ganze ist geschrieben wie ein Theaterstück, und, jetzt kommt’s: in Mundart. Ursprünglich auf Hessisch, was übrigens einer der am leichtesten zu erlernenden Dialekte ist, weil man einfach nur die Zunge loggä lasse muss. Wer sich noch gut an die letzte Betäubung beim Zahnarzt erinnern kann, parliert fließend Hessisch. Aber es gibt da noch ein paar andere hübsche Dialekte. Salzburgerisch etwa, Sächsisch, Schwäbisch – die Übersetzungen in all jene und viele mehr sind dem Hessischen angehängt, und die Riege der Verfasser kommt mit Harry Rowohlt und Otto Waalkes recht illuster daher.
Die ganze Bräsigkeit der Familie Breitlinger und die Bauernschläue, mit der sie schließlich durch den nadelnden Baum berühmt werden möchte, wirken erst im Dialekt richtig authentisch. „Kinner, was e Uffreschung!“ Gleichzeitig hat das Stück in jedem Dialekt eine andere Atmosphäre, weswegen auch nicht langweilig wird, was bei uns an Weihnachten passierte: Nach einer Lesung auf Kölsch folgten die Vorträge auf Bayerisch und Hessisch, und nur die Gans hielt uns davon ab, auch noch den Hamburger Zungenschlag zu würdigen, in der der Baum selbstverständlich nicht nadelt, sondern am Nadeln ist. Dieses enorme Repertoire an Dialekten ist übrigens nur einer von vielen Vorzügen einer umfangreichen Patchworkfamilie.
Solltet ihr also etwas langweilige Feiertage verbracht haben, bei denen euer Vater wieder Geschichten von früher erzählt hat und eure Mutter nur davon redete, dass ihr die Gans diesmal aber wirklich zu trocken geraten sei: Kauft dieses Buch fürs nächste Jahr. Es ist die reinste Stimmungskanone.
Was jetzt? Nächstes Jahr bringe ich das wieder mit. Wir haben ja noch Hamburg vor uns. Und meine Brüder dürfen nur noch Frauen anschleifen, die neue Dialekte mit einbringen.
Robert Gernhardt, Bernd Eilert, Peter Knorr: „Erna, der Baum nadelt!“ Mit Illustrationen von Volker Kriegel. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2010. 103 Seiten, gebunden, 10 Euro.
#33 – Charles Dickens: „Weihnachtsgeschichten“
Provenienz: Das lässt sich dank der Widmung ausnahmsweise sehr genau sagen: Meine Mutter bekam es zum zehnten Geburtstag von ihrem jüngsten Onkel geschenkt.
Ungelesen seit: In meinem Regal steht es nun wahrscheinlich auch schon seit zwanzig Jahren.
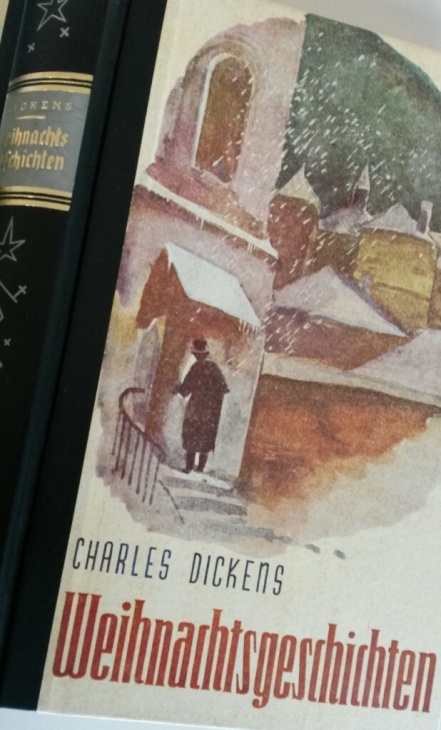 So sträflich, wie ich dieses Buch vernachlässigt habe, kann ich froh sein, dass mir kein Geist zum Behufe der Bekehrung erschienen ist. Natürlich kennen wir alle die klassische Weihnachtsgeschichte von Dickens um den geizigen und garstigen Ebenezer Scrooge, aber ich könnte nicht beschwören, sie gelesen zu haben. Gleichzeitig hat sie mich leider sogar ein bisschen gelangweilt, weil ich eben schon alles wusste. Noch mal in aller Kürze: Dem alten Scrooge erscheint zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht und nimmt ihn mit in seine einsame Kindheit, was ihm aus unerfindlichen Gründen sofort das Herz erweicht. Dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, dank dem er hören kann, wie jene über ihn reden, deren freundliche Einladungen er ausgeschlagen hat. Und, fast noch wichtiger: Was er bei ihren schönen Feiern verpasst. Der Geist der zukünftigen Weihnacht schließlich führt ihm vor, wie er gestorben ist und niemand um ihn trauert. Natürlich macht Scrooge daraufhin eine Kehrtwende und ist fürderhin ein liebevoller Onkel und freundlicher Mensch. Na ja.
So sträflich, wie ich dieses Buch vernachlässigt habe, kann ich froh sein, dass mir kein Geist zum Behufe der Bekehrung erschienen ist. Natürlich kennen wir alle die klassische Weihnachtsgeschichte von Dickens um den geizigen und garstigen Ebenezer Scrooge, aber ich könnte nicht beschwören, sie gelesen zu haben. Gleichzeitig hat sie mich leider sogar ein bisschen gelangweilt, weil ich eben schon alles wusste. Noch mal in aller Kürze: Dem alten Scrooge erscheint zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht und nimmt ihn mit in seine einsame Kindheit, was ihm aus unerfindlichen Gründen sofort das Herz erweicht. Dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, dank dem er hören kann, wie jene über ihn reden, deren freundliche Einladungen er ausgeschlagen hat. Und, fast noch wichtiger: Was er bei ihren schönen Feiern verpasst. Der Geist der zukünftigen Weihnacht schließlich führt ihm vor, wie er gestorben ist und niemand um ihn trauert. Natürlich macht Scrooge daraufhin eine Kehrtwende und ist fürderhin ein liebevoller Onkel und freundlicher Mensch. Na ja.
Erstaunlicherweise haben mir die anderen beiden Geschichten im Buch besser gefallen. Bei „Das Heimchen am Herd“ habe ich immerhin mal gelernt, woher dieser Ausdruck kommt: Man stellte Heimchen, also diese kleinen Grillen, in einem Käfig neben den Herd. Sie zirpten, wenn man den Ofen anheizte, und mehr und lauter, je heißer es wurde. Ein früher Feuermelder also. Und in Sachen Tierhaltung auch nicht so viel schlechter, als an eine Echse verfüttert zu werden, wie es den meisten heutzutage verkauften Grillen blüht.
Dieses Heimchen jedenfalls erfreut Dot, die junge Ehefrau des Fuhrmanns. Die beiden leben ein glückliches Leben, bis, ja, bis der Fuhrmann sich plötzlich mit einem verkleideten Mann und einer vermeintlichen Untreue seiner Frau konfrontiert sieht. Aber natürlich sind alle reinen Herzens und gute Menschen – bis auf den alten Spielzeugfabrikanten, den es zum Schluss recht hart trifft. Da hatte Dickens wohl keine Zeit mehr für Reue und Umkehr. Überhaupt sind die Grenzen zwischen Gut und Böse klar gezogen: Die einfachen Leute sind gut, die Reichen böse.
Das ist besonders eindrucksvoll in der dritten Geschichte abgebildet. „Silvesterglocken“ handelt von Toby, der sein Geld mit Botengängen und anderen kleinen Aufträgen verdient, und seiner Tochter Meg. Die Sprache ist generell wunderschön in dieser eulenalten Übersetzung, doch hier fällt mein Lieblingssatz, als der alte Mann sich vor der Kirche unterstellt: „Freilich ein windiger, gänsehäutiger, blaunasiger, rotäugiger, steinzehiger und zähneklappernder Warteplatz zur Winterszeit, wie Toby Veck wohl wußte.“ Zuerst trifft Toby auf den Friedensrichter, der ihn der hanebüchensten Dinge beschuldigt. Toby nehme etwa den Witwen und Waisen etwas weg, indem er Kuttelflecke äße. Darum wird ihm der letzte Bissen seines Mahls weggenommen. Das ist eine schrecklich demütigende Szene. Als nächstes begegnet Toby einem anderen reichen Mann, der groß davon spricht, wie er ihm helfen wolle: mit klugen Ratschlägen, und dafür erwarte er nur Undank, denn schließlich seien arme Menschen immer nur undankbar! Toby steht da, ist gezwungen, sich eine Unverschämtheit nach der anderen anzuhören, und bewahrt Haltung wie ein Boxer. Ab da geht es sogar noch bergab. Doch am Ende kommt alles in Ordnung. Schließlich ist Weihnachten!
Apropos: Frohe Weihnachten auch euch. Und, um es mit Dickens zu sagen: „Möge dann jedes Jahr glücklicher werden als das vorige!“
Was jetzt? Das Buch bringe ich an Weihnachten meiner Mutter mit.
Charles Dickens: „Weihnachtsgeschichten“. Erzählungen. Eduard Kaiser Verlag, 254 Seiten, vergriffen.
Die Geschichten stehen auch beim Projekt Gutenberg.